Die Sportjournalisten Christoph Kieslich und Florian Raz liefern das perfekte Geschenk für jeden FCB-Fan. Dass «111 Gründe, den FC Basel zu lieben» aber nicht nur für Fans lesenswert ist, zeigt dieser Auszug.
Wenn Kollegen ein Buch schreiben, kann die Redaktion es entweder ignorieren oder es einem externen Autor zur Besprechung abtreten. Weil es aber in der Schweiz kaum einen Journalisten gibt, der besser Bescheid weiss über den FC Basel als unser Christoph Kieslich und der nach Zürich abgewanderte Kollege Florian Raz («Tages-Anzeiger»), lassen wir ihr Buch für sich sprechen.
Die beiden Sportjournalisten liefern das perfekte Geschenk für jeden FCB-Anhänger. Dass «111 Gründe, den FC Basel zu lieben» aber nicht nur für Fans lesenswert ist, zeigen die folgenden neun Anekdoten. Weil die Geschichten spannend, aber auch sehr ausführlich sind, lotsen wir zu jeder einzelnen mit einem direkten Link:
- 7. Grund – Weil Spieler des FC Basel in Lugano die Tür einer Villa eintraten und dafür Cognac erhielten
- 20. Grund – Weil der FC Basel der polyglotteste aller Vereine ist – und schon immer war
- 26. Grund – Weil das Goldfüsschen lieber beim FC Basel als beim FC Barcelona spielte
- 60. Grund – Weil in Basel dr Babbe zu sim Sohn sait: Hüt kunnsch mit ins Stadion
- 66. Grund – Weil er vier Jahre, zwei Monate und elf Tage in Heimspielen ohne Niederlage blieb
- 88. Grund – Weil ein Erzrivale sein Clubmagazin nach jener 93. Minute benannt hat, in der er dem FCB einen Titel entreissen konnte
- 96. Grund – Weil Marco Walker mit einem Schuss übers Dach berühmt wurde
- 97. Grund – Weil Sascha Rytschkows Kater tatsächlich Wodka hiess
- 103. Grund – Weil die ganze Stadt Basel in Châtel-St-Denis dabei war, offiziell aber nur 400 Zuschauer vermeldet wurden
7. Grund – Weil Spieler des FC Basel in Lugano die Tür einer Villa eintraten und dafür Cognac erhielten
Es ist der späte Nachmittag des 22. November 1931, als Sepp Büttiker «in vollem Laufe» seine 80 Kilogramm gegen eine geschlossene Tür in Lugano Paradiso wirft. Einmal, zweimal, dann birst das Holz – und zehn Basler stehen in einer edlen Tessiner Villa. «Gottlob gab es keine Ohnmachtsanfälle der Damen», notiert Büttiker später in der Vereinschronik des FC Basel, «wir hatten im eigenen Lager deren genug.» Es ist ein trauriger Haufen, der da verarztet werden muss, mit Wasser für die Wunden und «Cognac zur Stärkung von Leib und Seele». Und wenn Büttiker die Verletzungen aufzählt, klingt es nach einer überstandenen Kneipenschlägerei: «Remay stillte das rinnende Blut an seinem Kopfe, Blumer lag mehr tot als lebendig auf einem Divan, Kielholz sah geistesabwesend ins Leere, Enderlin II war mit einem Loch knapp über dem Auge beglückt worden.»
Doch die Basler sind nicht auf dem Heimweg nach einem aus dem Ruder gelaufenen Saufgelage. Sie haben kurz zuvor das Wiederholungsspiel im Sechzehntelfinal des Schweizer Cup beim FC Lugano 1:0 gewonnen. Die Stimmung unter den 3000 anwesenden Tifosi ist dabei schon vor dem Anpfiff hitzig. Die Tessiner Presse hat nach dem 3:3 im ersten Spiel, die Basler holen einen 0:3-Rückstand auf, laut Büttiker «die unglaublichsten Gerüchte in Umlauf gesetzt». Als dann Schiedsrichter Wüthrich in Lugano kurz vor Schluss nach einem angeblichen Handspiel eines Baslers keinen Elfmeter pfeift, sondern das Spiel kurz darauf mit einem Basler Sieg beendet, brechen alle Dämme.
«Ich habe selbst holde Schöne mit Steinen und Schmähworten um sich werfen sehen», beschreibt Büttiker die Szenen auf dem Campo Marzio. Die Situation wird richtig gefährlich: «Faustdicke Steine sausten auf uns oder zerschmetterten die Kabinenfenster.» Selbst der Teamarzt der Luganesi trägt am Hinterkopf eine blutende Wunde davon und weint in der Basler Garderobe «resigniert in sich hinein». Der Schiedsrichter und die Basler müssen sich eine halbe Stunde lang verschanzen, dann wird ihnen angeboten, über das direkt am See gelegene Feld auf ein Boot zu flüchten.
«Die Revolver wurden entsichert und der heissblütigen Menge entgegengestreckt.»
Doch damit sind die Basler keineswegs in Sicherheit. Schnell spricht sich unter der Meute herum, wohin das Schiff unterwegs ist: Nach Paradiso, wo das Hotel steht, in dem sich der FCB vor dem Spiel umgezogen hat. Als sich die Basler dem Ufer nähern, ist der Quai deswegen bereits «mit Menschen besetzt, die unsere Ankunft ‹freudig› erwarteten». Der Gang zum kaum 100 Meter von der Anlegestelle entfernten Hotel wird zum Spiessrutenlauf – oder zum «Gang nach Golgatha», wie der bibelfeste Büttiker notiert.
Die Basler werden getrennt. Ein Teil schafft es auch dank der Hilfe von Zivilpolizisten ins Hotel. Als auch der Kommissar von Lugano verletzt wird, ziehen die Schutzleute ihre Schusswaffen: «Die Revolver wurden entsichert und der heissblütigen Menge entgegengestreckt.» Der andere Teil des FCB-Trosses, mit Büttiker, flüchtet in eine nahe stehende Villa.
Erst um ein Uhr morgens können der FCB und der Schiedsrichter schliesslich von Chiasso aus die Heimreise antreten, im Camion werden sie an den Bahnhof gefahren. Dort gibt es eine kleine Siegesfeier, zu der einige Spieler des FC Chiasso erscheinen und bei der der Tessiner Polizeipräsident das Bier spendet.
Der FC Lugano wird für die Ausschreitungen mit einer Platzsperre belegt. Bis zum Ende der Saison muss er seine Heimspiele mindestens 100 Kilometer von Lugano entfernt austragen. Die Basler kommen in dieser Cupsaison bis in den Halbfinal, wo sie den Grasshoppers gleich mit 1:8 unterliegen. Ein Jahr darauf gelingt ihnen im Cupfinal die Revanche für diese Schmach, und sie gewinnen ihren ersten offiziellen Pokal.
20. Grund – Weil der FC Basel der polyglotteste aller Vereine ist – und schon immer war
Basel brüstet sich gerne damit, eine weltoffene Stadt zu sein. Möglich, dass Auswärtige ob der Basler Eigenarten, wie etwa der allgegenwärtigen Ironie und der vorherrschenden Meinung, Basel sei die weltbeste aller Städte, leichte Anlaufschwierigkeiten haben können. Aber wer sich durchbeisst, kann sich einen Platz im Herzen der Bevölkerung erobern. Über 35 Prozent der Basler Bevölkerung haben keinen Schweizer Pass. Keine Frage deshalb, dass die Helden des FC Basel nicht allesamt am Rhein zur Welt gekommen sein müssen. Helmut Benthaus, der Mann, der den FCB zur Fussballgrossmacht werden liess? Ein Deutscher. Christian Gross, der die Benthaus-Jahre sogar noch überstrahlen sollte? Ein Zürcher. Scott Chipperfield, mit 13 Titeln erfolgreichster FCB-Spieler der Geschichte? Ein Australier (inzwischen eingebürgert, weil er von der Region einfach nicht loskommt).
Mindestens 206 Spieler mit ausländischem Pass haben das Trikot des FC Basel bislang getragen. Möglich, dass sogar noch der eine oder andere in den jungen Jahren des Vereins den Chronisten durch die Lappen gegangen ist. Und es ist keineswegs so, dass ihre Zahl erst in der Neuzeit nach der Abschaffung der Ausländerbeschränkung im Schweizer Fussball explodiert ist. Nein, der FCB war schon in seinen jüngsten Jahren international geprägt.
Der erste und bislang einzige Engländer zum Beispiel war Archibald E. Gough und spielte von 1900 bis 1902 in der ersten Mannschaft des FCB. Er war einer der engagiertesten Basler Fussballer zur Jahrtausendwende. Ausser beim FCB war er auch noch Captain des FC Gymnasia, der deswegen manchmal auch als Goughs Team unterwegs war. Und 1894 spielte er auch gleich noch mit dem FC Buckjumpers ein Freundschaftsspiel gegen den FCB.
Ja, auch das babylonische Sprachgewirr in der Kabine ist keine Erfindung von Christian Gross, den es immer sichtlich mit Stolz erfüllte, wenn er seine Ansprachen in mindestens vier gemischten Sprachen abhalten durfte: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch! Schon 1912 beantragte Captain Emil Hasler, beim FCB solle künftig Schriftdeutsch gesprochen werden, um «die verschiedenen in- und ausländischen Dialekte zu umgehen».
In der Neuzeit haben immer wieder mal Trainer versucht, wenigstens Schriftdeutsch als Hauptsprache in der Kabine und auf dem Platz durchzusetzen. Meist reichlich erfolglos. Als Thorsten Fink seine ausländischen Spieler in den Deutschkurs schicken wollte, endete die Geschichte damit, dass das Trainerteam samt Pressesprecher und Sportdirektor Spanisch-Lektionen besuchte.
Inzwischen ist es so, dass all die Japaner, Argentinier, Paraguayaner, Bulgaren oder Tschechen zwar oft Sprachkurse belegen – aber nicht Deutsch, sondern Englisch. Und über den portugiesischen Weltumsegler Paulo Sousa, der seine Stippvisite in Basel mit dem Versprechen antrat, «so schnell als möglich Deutsch zu lernen», schweigt an dieser Stelle die Höflichkeit.
Dass der FCB-Trainer der Saison 2015/16 wieder auf Mundart setzt, ist aller Ehren wert. Selbst wenn es sich dabei um Züritüütsch – und damit um das in Basel wohl unbeliebteste aller Idiome handelt. Aber auch der Ur-Zürcher Urs Fischer wird nicht umhinkommen zu lernen, dass der FC Basel der polyglotteste aller Fussballvereine ist.
Oder wie erzählte Daniel Höegh, im Sommer 2015 einer der neuen Ausländer im FCB-Trikot, nach seinem ersten Training in Basel? «Ich habe in der Garderobe Englisch gehört, Spanisch, Italienisch, etwas Französisch – und auch Deutsch.» Und als sich der Däne hilfesuchend mit der Frage an den argentinischen Nebenmann Walter Samuel wandte, welche Sprache denn nun hier bitteschön eigentlich gesprochen werde, erklärte der seelenruhig: «Das ist immer so. Du wirst dich daran gewöhnen.»
26. Grund – Weil das Goldfüsschen lieber beim FC Basel als beim FC Barcelona spielte
Es gibt Spieler, die beeindrucken die Massen, weil sie viele Tore schiessen. Es gibt Spieler, die faszinieren, weil sie auf und neben dem Feld ein bisschen quer schlagen und immer für eine nette Episode gut sind. Und es gibt Spieler, die beides vereinen – und darum zur Legende werden. Josef «Seppe» Hügi gehört zur letzten Kategorie. Er verzaubert die Massen und ist der erste richtige Star in den Reihen des FCB. Wobei es diesen Ausdruck in seiner Zeit für Fussballer noch gar nicht gibt. Von 1948 bis 1962 spielt er bei den Rotblauen und schiesst in dieser Zeit sagenhafte 282 Tore in 363 Spielen. Hügi ist und bleibt damit bis in alle Ewigkeit Basler Rekordschütze.
Wie Hügi II (sein Bruder Hans ist Hügi I) diese Tore erzielte, darum rankt sich rasch ein Mythos. Der spätere Chefredaktor der «Basler Zeitung», Hans-Peter Platz, schreibt von «Seppe, der nie ein gewöhnliches Goal erzielte. Das war immer mehr: Kopftore im Flug erzielt, Direktabnahmen ohne Bodenberührung versenkt, Fallrückzieher, Sololäufe, Freistosshämmer und lauter Unhaltbare.» Kein Wunder, wird Seppe in Basel schnell zum «Goldfiessli» – das Goldfüsschen.
«Das Fleisch wäre willig gewesen, aber ich war ja noch so jung und fand einfach den Mut nicht.»
Heute läge Hügi die Fussballwelt zu Füssen. Ein Millionen-Transfer ins Ausland? Kaum zu verhindern. Der Stürmer könnte ein reicher Mann werden, keine Frage. Doch Hügi lebt in einer anderen Zeit. Wobei er die Chance gehabt hätte, ins Ausland zu gehen. Der FC Barcelona will ihn verpflichten, als er 19 Jahre alt ist. Hügi selbst erinnert sich später in seinem Buch an das Geld, das ihm geboten wurde: «Himmel, war das ein Angebot!» Es soll zum Vertragsabschluss in einer Basler Bar kommen. Doch während «eine strahlende Blondine spärlich bekleidet die Tanzpiste betrat», traut sich Hügi nicht, den Kontrakt zu unterzeichnen: «Das Fleisch wäre willig gewesen, aber ich war ja noch so jung und fand einfach den Mut nicht.»
1956 hat er noch einmal ein goldenes Angebot vorliegen. Während der Ferien in Italien trainiert er beim FC Genua mit, weil er «wie immer» jede Gelegenheit ergreift, Fussball zu spielen. Schliesslich kommt es so weit, dass Hügi als «Mr. X» ein Testspiel gegen das argentinische Team aus San Lorenzo bestreitet. Für Hügi ist es «ein Heidenspass», dass die italienische Presse danach ganz aufgeregt über den geheimnisvollen Unbekannten schreibt. Einen Tag darauf aber bittet ihn ein netter Herr («Zigarette bitte?») an seinen Tisch und unterbreitet ihm im Namen von Genua einen fixfertigen Vertrag. «Ich las und staunte», schreibt Hügi, «das waren Zahlen!» Wieder entscheidet er sich für die Vereinstreue. Und findet später: «Heute weiss ich, das war ein Fehler.»
So ist und bleibt Seppe Hügi einer der letzten grossen Amateure des Schweizer Fussballs. Zu den Spielen auf dem Landhof erscheint er meist eher knapp vor Anpfiff mit seiner Familie, er schiesst sich an einer Wand hinter der Haupttribüne warm. Nach Spielschluss trinkt er einen im Stadionrestaurant, ehe er wieder zu Fuss nach Hause marschiert. Unweit des Stadions wohnt er – und er arbeitet dort auch; als Angestellter des Malermeisters Fritz Klauser.
Hügi ist also einer zum Anfassen, was neben seinen Toren einen wesentlichen Teil seiner Popularität ausmacht. Er ist aber auch einer, um den sich schnell Geschichten ranken, weil er auf dem Platz ein Schlitzohr ist – und daneben ebenso. Hügi traut sich Dinge, die sich andere Jungs nicht trauen. Aber weil es keine TV-übertragungen gibt, bleibt vieles bloss Fama. Hat er damals vor dem Schiedsrichter zur Unterstreichung des berühmten Zitats des Götz von Berlichingen wirklich die Hosen heruntergelassen?
Hügi ist aber auch einer, um den sich schnell Geschichten ranken, weil er auf dem Platz ein Schlitzohr ist – und daneben ebenso.
Sicher ist: Hügi ist kein «spielender Mittelstürmer», wie ihm Wikipedia freundlicherweise nachsagt. Hügi ist ein Angreifer sehr alter Schule, das heisst: Er steht in der Spitze und wartet auf seine Chancen, die er dann zu verwerten pflegt. Lauffreude? Ist eher nicht sein Ding. Kein Wunder, hält sich noch bis in seine Zeit bei den Senioren des FCB das Gerücht, Hügi habe während seiner ganzen Karriere höchstens beim Anstoss die eigene Platzhälfte betreten. Von 1951 bis 1953 wird Hügi dreimal in Serie Schweizer Torschützenkönig.
Eigentlich logisch, dass in diese Zeit auch der erste Basler Meistertitel 1953 fällt. In jener Saison trifft Hügi in 23 Spielen 32 Mal ins gegnerische Tor. 1954 wird er mit sechs Toren der erfolgreichste Schweizer Torschütze an einer Weltmeisterschaft, ein Rekord, der bis heute Bestand hat. Drei der Treffer erzielt er bei der 5:7-Niederlage gegen Österreich im Viertelfinal. Es ist noch immer die torreichste Partie der WM-Geschichte.
Seinen grössten Auftritt aber hat er 1960 im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft. Es mag nur ein Freundschaftsspiel sein, das die Schweizer an diesem 12. Oktober im Stadion St. Jakob austragen. Aber das macht zu jener Zeit keinen grossen Unterschied. 40’000 strömen ins Joggeli, um «Les Bleus» zu sehen, die WM-Dritten von 1958. Zur überragenden Figur des Abends aber wird kein Franzose. Es ist Goldfiessli, der Geschichte schreibt. Fünf Tore erzielt Hügi an diesem Abend, drei davon als Hattrick, wie er lupenreiner nicht sein könnte. Die Tore zum 3:1, 4:1 und 5:1 erzielt Hügi mit rechts, links und mit dem Kopf. Dazu ein Treffer vor der Pause zum 2:1 und einer zum Schlussstand von 6:2.
Seppe «Goldfiessli» Hügi ist damit bis heute jener Schweizer, der die meisten Tore in einem Spiel erzielt hat. Etwas anderes würde seinem Ruf als Goalgetter auch gar nicht entsprechen. Und auch die Reaktion auf den Triumph darf als typisch Hügi gelten: Als er danach wieder beim FCB im Training erscheint, erklärt er: «So, jetzt mache ich nichts mehr, verbessern kann ich mich ohnehin nicht mehr.»
Seine Karriere lässt er in Pruntrut und Laufen ausklingen. Eines seiner letzten Tore schiesst er im Achtelfinal des Schweizer Cup in der Saison 1963/64 für Pruntrut. Sein Team gewinnt etwas überraschend 1:0 – ausgerechnet der FC Basel muss die Segel streichen. 1995 stirbt Seppe Hügi mit 65 Jahren in seinem Geburtsort Riehen.
60. Grund – Weil in Basel dr Babbe zu sim Sohn sait: Hüt kunnsch mit ins Stadion
Die Fans der Muttenzerkurve und ihre Lieder – auch das ist ein spezielles Kapitel des Basler Fussballs. Was früher schlicht klang («Olé, super FCB») sind heute kreative, durchdachte Kompositionen und Adaptionen.
Eines der bekannteren Motive in Fussballstadien wurde in den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren ausgerechnet einer US-Band entlehnt: Aus Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye wurde auf den Rängen des Joggeli Nananana Nananana Hee Hee Hee, Eff Cee Bee. Das Lied kam auf Vinyl, weil Karli no ne Gool, ein originärer Basler Ohrwurm aus der Feder von Peter Felix, eine B-Seite brauchte.
Popsongs mit eingängigen Melodien sind seit jeher ein dankbares Feld, auf dem sich Fussballfans bedienen. Und ihre Anleihen halten sich lange. Der Musikpädagoge Reinhard Kopiez hat das in seinem Buch Fussball-Fangesänge – eine FANomenologie so beschrieben: «Die Fans singen noch immer die Unterhaltungsmusik aus dem Keller ihrer Eltern.» Wie wahr: Steht auf, wenn ihr Basler seid (Go West; Pet Shop Boys) ist nicht totzukriegen.
Die Muttenzerkurve hat sich inzwischen verändert und damit auch ihre Lieder. Aus Zweizeilern sind mehrstrophige Werke geworden, die es der grossen Masse des Restpulikums nicht einfach machen, zu folgen. Ausnahmen sind auf das Spiel bezogene Momente kollektiver Ekstase, in denen klargemacht wird: «Wär nid gumpt dä isch kai Basler».
Früher war es einfacher, den FC Basel akustisch zu unterstützen – haben Thilo Mangold und Claudio Miozzari, damals Mitarbeiter des Sportmuseum Schweiz, 2012 in einem Beitrag («Lumpenlieder und andere Fiesheiten») für die TagesWoche festgehalten. We love you Basel, we do; Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht; Gebt mir ein U (Uffta) wurden aus der Bundesliga abgekupfert und verschwanden Mitte der Nullerjahre wieder. Mangold/Miozzari schreiben: «Mit den aktiven Fans kam viel Kreativität ins Stadion. Vermehrt entstanden eigene Lieder. Südamerika oder zumindest Südeuropa wurden die neuen Inspirationsgebiete. Junge Kurvensoldaten lernen die Texte von den älteren. Der urbane Basler Trend-Ultra schreit kaum noch unkontrollierten Wahnsinn. Die Lieder sind oft kurvenpolitisch gefärbt, selbstherrlich und scheintraditionell. Und genau darum singen sie sich so fantastisch – wenn man sie einmal kennt.»
Mit dem Meistertitel 2002 erlebte ein Klassiker eine Renaisance:
Glaubed nid an Gaischter, glaubed nid an Gaischter, dr FCB wird Schwiizermaischter. Das ist auch bei der jungen Kurvengeneration mehrheitsfähig. Von der Fasnacht 2010, der FC Basel hat im Meisterschaftsrennen gerade mächtig aufgeholt auf die führenden Young Boys, stammt ein Medley der Schnitzelbangg «d’Strigedde», die ihrem dringlichen Wunsch (Wir wollen dieses Jahr eine Meisterfeier) Nachdruck verleiht mit einer hübschen Strophe:
«Ooooh in dr Tabälle
sin no Plätzli frei grad wyter hinte
ab Platz 2 oder 3 das wird euch gfalle
und zwar euch alle vo Genf bis noch St. Galle!»
Unterdessen wird das abgestiegene Genf gerne durch «Zyri» (Zürich) ersetzt, und das Lied hat sich zu einem Gassenhauer verfestigt. Wie neue Lieder grundsätzlich ins Stadion kommen, schildert das ehrenwerte Schweizer Fussball-Magazin «Zwölf» in einer zeitlos schönen Sonderpublikation zum Thema Fankultur. Unter dem Titel «Der Chor hinterm Tor» heisst es:
«Heute ist der Capo eine Art Türsteher für neue Gesänge. Ist er mit einem Vorschlag einverstanden, hat dieser gute Chancen, bald von der ganzen Anhängerschaft gesungen zu werden. Auf Auswärtsfahrten, wo der harte Kern – und damit die besonders singfreudigen Fans – dabei ist, werden Zettel mit dem Text und einem Hinweis auf die Melodie verteilt. Wenn die Premiere im fremden Stadion gut verläuft, wird das Gleiche im deutlich grösseren Rahmen am Heimspiel versucht.»
Die Muttenzerkurve geht mit den Texten ihrer Lieder – sagen wir: haushälterisch um. Sie werden quasi wie eine geheime Währung gehandelt, und die Liedtexte gibt es ausdrücklich nur für aktive Kurvengänger. Heutzutage macht man das per Liedtext-SMS.
Ein Klassiker im Strophenrepertoire der Kurve:
«Fuessball, das isch unser Läbe, d Kurve isch unser dehei,
do bisch wie im siebte Himmel, do fühlsch die niemols elei»
Und weiter:
«Erfolg isch nit alles im Läbe
Au wenns schlecht goht sin mir mit drby
FCB-Fan kasch nit wärde
FCB-Fan das muesch si!»
Die Kurve skandiert «Allez, Allez, FCB» und «Los, los, los» und:
«Alles gäh, für Rot und Blau,
uff em Fäld und in dr Kurve au.
Nid für e Lohn, für d Region,
FC Basel schiess das Goal!»
Eine Adaption von Stings Englishman in New York ist Oh, lüter singe, immer lüter singe, bis der FCB s Goal gschosse het. Wenn die eigene Mannschaft sich von der narkotisierenden Wirkung dieser Endlosschleife freimachen kann, ist der Erfolg garantiert.
Natürlich gibt es auch noch das Basler Lied Z Basel am mym Rhy, aber der Klassiker schlechthin ist, als der Vater zu seinem Sohn sagt: Heute kommst du mit ins Stadion. Aus gegebenem Anlass hier in voller Länge:
Sait dr Babbe zu sim Sohn
Hüt kunnsch mit in s Stadion
D Mamme, wo an dr Türe stoot Weiss, dass jetzt e Gschicht aafoot
Nimm dä Schal und gib mir d Hand
Ich entfiehr di ins Fuessballland
Loss di triibe vo de Fans in Blau und Rot Zobe seisch mir denn, willsch wider go
Und in dr Nacht, do träumsch no lang
Vo dr Kurve und ihrem Gsang
Möchtsch mol dörte stoo, wo alli andere stöhn Lieder Singe, wo eso aaföhn
Im rotblaugääle Baslergwand
Sin mir usser Rand und Band
Gumpe, zünde, Lieder schreie Fahne schwängge, duuregheie Rot und Blau, dr FCB
Nati A oder Nati B
D Kurve die stoot hinde dra Mir sin eure zwölfte Maa Und fahre mir au no so wit Für uns isch das e schöni Zit Muttenzerkurve egal Wohi FCB – mir liebe di!
Und so klingt das dann (ab 50. Sekunde):
66. Grund – Weil er vier Jahre, zwei Monate und elf Tage in Heimspielen ohne Niederlage blieb
Es beginnt mit einem 4:2 gegen den FC Biel – und danach will der FC Basel sehr, sehr lange Zeit nicht mehr vor eigenem Publikum verlieren. Wir schreiben die Saison 1968/69, und es ist die Blütezeit unter Helmut Benthaus. 1967 feiert Basel den zweiten Meistertitel seiner Vereinsgeschichte und erstmals das Double. Die darauffolgende Saison beendet er als Fünfter und unterliegt dem späteren Meister FC Zürich im letzten Heimspiel. Das sollte ihm dann sehr, sehr lange Zeit nicht mehr passieren.
Genau genommen werden es vom 1. Juni 1968 und von jenem 1:2 gegen den FCZ an vier Jahre und 72 Tage, bis der FCB das nächste Mal vor heimischer Kulisse als Verlierer vom Platz muss. 219 Wochen sind das, oder 1533 Tage, oder 36’792 Stunden, mehr als zwei Millionen schier nicht enden wollende Minuten für die Gastmannschaften im Joggeli. Und fast so viele Glücksmomente für die Rotblauen.
Am Ende der Serie sind es 52 Meisterschafts-Heimspiele ohne Niederlage, 40 Siege werden in dieser Zeit eingefahren, und zwölf Partien enden unentschieden. Und weil eine makellose Heimbilanz die Grundlage für eine erfolgreiche Saison ist, geht die Erfolgsgeschichte des FC Basel in dieser Zeit weiter: Meister 1969, Meister 1970 und Meister 1972. Zu einem vierten Titel in dieser Serie reicht es nicht, weil 1971 ein Entscheidungsspiel zwischen dem punktgleichen FCB und GC nötig wird, das die Zürcher in Bern mit 4:3 nach Verlängerung für sich entscheiden. In jener Saison 1970/71 gewinnt der FCB zwölf seiner 13 Heimspiele, lediglich Servette Genf entführt mit einem 2:2 den einzigen Punkt, den es für ein Gastteam in Basel zu holen gibt.
Die Mannschaft verliert in dieser Saison ein einziges Mal, auswärts mit 1:4 bei den Young Boys.
1971/72 schraubt der FCB mit zehn Heimsiegen und drei Remis im Joggeli die Serie auf die Rekordhöhe von 52 Spielen ohne Niederlage. Es ist die Zeit von Marcel Kunz, von René Hasler, dem jungen Jörg Stohler, Walter Mundschin und Urs Siegenthaler, von Otto Dermarmels, Peter Ramseier, der Achse mit Karl Odermatt, Jürgen Sundermann und Walter Balmer sowie Ottmar Hitzfeld. Diese Mannschaft verliert in dieser Saison ein einziges Mal, auswärts mit 1:4 bei den Young Boys. Unbeirrt eilt der FCB von Erfolg zu Erfolg, zieht die Massen an und stellt einen Nationalliga-Rekord mit einem Zuschauerschnitt von 18’800 Zuschauern auf.
Den Spielern selbst ist gar nicht bewusst, was sich da rein rechnerisch auftürmt. «Es ging um den Nimbus, aber die Anzahl der Spiele hat keine Rolle gespielt», erinnert sich Otto Demarmels über 30 Jahre später. Der grosse Helmut Benthaus («Ich bin kein Statistiker») sagt im Rückblick, erst durch eine Karikatur in der «National-Zeitung» zum ersten Mal richtig aufmerksam gemacht worden zu sein. Die erscheint zum 50. Heimspiel ohne Niederlage, einem 2:1 gegen den FC Winterthur, und der renommierte Zeichner Hans Geisen lässt, vor dem Hintergrund fahnenschwenkenden Matchbesucher auf dem Heimweg, einen Bub sagen: «Wenn y dängg, wie mängmool y in de letschte vier Johr daheim gschlage worde bi!»
Die beispiellose Serie mündet schliesslich in einem einsamen Höhepunkt. Man schreibt den 12. Juni 1972, und der FC Zürich kommt zum letzten Meisterschaftsspiel nach Basel. Dem zwei Punkte voraus liegenden FCB reicht ein Unentschieden, um erneut ein Entscheidungsspiel, diesmal gegen den FCZ, zu verhindern. Es wird ein kolossales Fussballfest für Basel. 56’000 Zuschauer zu St. Jakob bilden eine Kulisse, die es vorher und nachher nicht mehr gab im Schweizer Clubfussball, und aller Voraussicht nach wird diese Zahl aufgrund der Grösse der Stadien heutigen Zuschnitts für alle Ewigkeit Bestand haben.
Der FCB gewinnt glorios. Mundschin, zweimal Odermatt und Hitzfeld treffen zum 4:0, und unvergessen ist, wie FCZ-Trainer Timo Konietzka seine Spieler anhält, Spalier für den Meister zu stehen und den Baslern zu applaudieren. Die Stadt schwelgt in Rot und Blau und feiert die fünfte Meisterschaft, und ganz nebenbei steht die Serie nun bei 52 Heimspielen ohne Niederlage.
Sie endet schon mit dem ersten Spiel der darauf folgenden Saison. Und wie könnte es anders sein, als dass es ein Dreizehnter ist: Am 13. August 1972 kommt der FC Sion und gewinnt mir-nichts-dir-nichts mit 3:2. «S isch passiert», notiert die «National-Zeitung» anderntags lapidar – es ist passiert. Und Rolf Klopfenstein (1940–2010), ein Doyen der Fussballschreiber, machte im anderen Lokalblatt, den «Basler Nachrichten», die Niederlage fest an der «Torhüterschwäche», an der Absenz von Karl Odermatt («Die ordnende Hand, seine Kunst und Ausstrahlungskraft fehlte an allen Ecken und Enden»), aber immerhin auch an einem «starken Gegner». Sei’s drum, sagt sich der FCB – und wird am Ende dennoch zum sechsten Mal Meister.
88. Grund – Weil ein Erzrivale sein Clubmagazin nach jener 93. Minute benannt hat, in der er dem FCB einen Titel entreissen konnte
Die Umstände dieser Entstehungsgeschichte waren dramatisch, was nach jener ominösen 93. Minute am 13. Mai 2006 folgte, war sogar schrecklich, nicht nur für den FC Basel, sondern für das Image des Schweizer Fussballs insgesamt. Viele in Basel, zumindest jene, die mit dem FCB fiebern, wollen natürlich an diesen vielleicht schwärzesten Tag der Clubgeschichte nicht mehr erinnert werden. Den sicher geglaubten Meistertitel gab man in der Nachspielzeit des 36. Saisonspiels aus den Füssen, oder soll man besser sagen: aus den Händen. Weil es ein hinterher von den Baslern beklagter, zu weit vom eigentlichen Ort des Geschehens ausgeführter Einwurf war, dem die Flanke von Florian Stahel folgte und dann, tja – «schüsst Iulian Filipescu de Bölle ins Goal», würde der Zürcher sagen. Titel futsch für den FCB, ekstatischer Zürcher Jubel, abgrundtiefer Basler Frust, Eskalation im und um den St.-Jakob-Park.
Das historische Ereignis – schliesslich hatten der FC Zürich und sein langjähriger Präsident Sven Hotz seit 1981 auf einen Meistertitel gewartet – nahm der FCZ zum Anlass, ein neues Clubmagazin zu lancieren. Mit dem durchaus originellen und aus Basler Perspektive natürlich diabolischen Namen «93. Minute». Das Hochglanzprodukt beschäftigte sich wie alle Clubmagazine mit diesem und jenem, es erschienen grossflächige Geschichten über die Protagonisten des Vereins, der neue Präsident Ancillo Canepa wurde natürlich auch gefeiert, und der dankte es mit grossen Projekten: Dem 2010 erschienenen, 400 Seiten starken Kompendium «Eine Stadt, ein Verein, eine Geschichte – Der FC Zürich von 1896 bis heute», und ein Jahr später wurde das liebevoll gestaltete FCZ-Museum eröffnet.
88 Seiten «93. Minute» kosteten im Einzelverkauf stolze zehn Franken. Es konnte sich von der Aufmachung her sicherlich messen mit dem bereits seit März 2002 erscheinenden Magazin «Rotblau» des FCB, auch wenn die Zürcher nicht die statistische Tiefe und Akribie von Rotblau-Chefredaktor Josef Zindel erreichten. Anfangs erschien «93. Minute» sechsmal pro Jahr, dann nur noch viermal, schliesslich noch zweimal, ehe es im Juni 2013 zusammen mit dem clubeigenen Internet-TV einschlief. Oder besser gesagt: dem Kostendruck eines zum Sparen gezwungenen Präsidenten zum Opfer fiel.
«Bis auf weiteres eingestellt», heisst es seither auf der Website des Clubs. De facto gibt es somit die «93. Minute» eigentlich gar nicht mehr. Was dem Basler ein Trost sein mag.
96. Grund – Weil Marco Walker mit einem Schuss übers Dach berühmt wurde
Damit das gleich gesagt ist: Marco Walker hat einmal mit dem Kopf in der 90. Minute den 1:0-Siegtreffer gegen die Grasshoppers erzielt. Und weil das Tor in eine Zeit fiel, in der GC noch der Dominator des Schweizer Fussballs war, fühlte sich dieses Tor auf den Stehplatzrampen des alten Stadions St. Jakob ein wenig wie ein Meistertitel an. Aber Walker hat sich längst damit abgefunden, dass das nicht die Szene ist, mit der er seinen Platz in der Erinnerung der FCB-Fans erobert hat.
Nein, der ehemalige Verteidiger ist für immer mit dem alten Joggeli und einem missratenen Befreiungsschlag aus dem Jahr 1995 verbunden. «Nun, ja, dass ich ab und zu einen Ball quer durchs Stadion schlug, das ist eine bekannte Tatsache», erzählt Walker später der «Basler Zeitung»: «In jener Szene gegen YB traf ich ihn dann halt ziemlich wuchtig und ziemlich anders als geplant. Er ging höher als gewollt und in die falsche Richtung – schon war er weg.»
Und weg hiess in diesem Fall: Der Ball flog in beeindruckender Kurve auf das Dach der Haupttribüne, «ein klarer Eisenbetonbau», wie es in der Baubeschreibung der Architekten J. Gass & H. Boos heisst. Wobei vor allem etwas interessiert, um Walkers Bogenlampe zu würdigen: «Das Dach besteht aus Eisenbetonkragträgern mit Welleternitdeckung auf Holzbalkenlager. Fassadenhöhe 18,50 Meter, Kragbinderausladung 25,25 Meter, höchste Binderhöhe über Spielfeld 24 Meter.»
Über 24 Meter Höhe also gewann der Ball durch Walkers (im wahrsten Sinn des Wortes) starken linken Fuss. Aufgetaucht ist die Kugel danach nicht mehr, trauert Walker: «Der Materialwart hat ja noch nach ihm gesucht. Auf dem Dach war er nicht liegen geblieben, ausserhalb des Stadions ward er nie mehr gesehen. Schade, damals habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Inzwischen hätte ich ihn aber sehr gerne als Souvenir.»
Marco Walker ist 2015 zum zweiten Mal Assistenztrainer in der ersten Mannschaft des FCB geworden, verantwortlich für die körperliche Fitness der Spieler und mit dem übernamen «Ranger» versehen. In seiner ersten Zeit als Assistent hat er noch einmal neben dem Platz für Schlagzeilen gesorgt: Als Mann, der nur kurze Hosen trug. Selbst dann, wenn der FCB im Moskauer Luschniki Stadion bei minus 20 Grad Celsius antrat.
Es war die Freude an der Beinfreiheit und ein gerüttelt Mass an Aberglaube, die Walker stets kurze Hosen tragen liessen, wenn er auf der Basler Bank sass. Inzwischen aber muss er wohl oder übel auch mal lange Beinkleider anziehen: Der Arzt hat ihm dringend dazu geraten, um seine Knie zu schonen.
97. Grund – Weil Sascha Rytschkows Kater tatsächlich Wodka hiess
Es war Sommer 1998, als René C. Jäggi einen neuen Spieler vorstellte. «Das ist mein Projekt Sascha», erklärte der damalige FCB-Präsident der Presse. Und diese spezielle Ankündigung hatte ihren Grund. Oder besser: ihre Gründe. Alexander «Sascha» Nikolajewitsch Rytschkow war zuvor bei Standard Lüttich wegen überhöhtem Alkoholkonsum durchgefallen, danach wurde er bei Lens entlassen, weil er in einer Dopingkontrolle hängen geblieben war – mit Cannabis. Und schliesslich zeigte der Alkoholtest bei einer Polizeikontrolle in Köln einen Wert von über zwei Promille, was weitaus beachtlicher war als das, was er beim 1. FC auf dem Rasen zeigte.
Saufen, das war also bereits vor seiner Ankunft in Basel klar, konnte dieser Russe aus Sibirien. Aber er konnte auch verdammt gut kicken, was in dieser sonst reichlich mittelmässig talentierten Basler Mannschaft vielleicht noch etwas besser zur Geltung kam. Kaum drei Spiele brauchte der 23-Jährige – und er war Publikumsliebling. Dass er sich daneben durchaus einen Sinn für das Nachtleben erhalten hatte, störte nicht gross. Solange ein FCB-Profi gut spielt, darf er auch die Nächte zum Tag machen, da sind die Basler nicht so streng.
Es gibt nur wenig Menschen, die ihre Heimat weniger gerne verlassen als Russen. Betrunkene Russen zum Beispiel.
Dieser Rytschkow also legte sich in seiner Basler Zeit einen Kater zu. Und er hatte tatsächlich keine bessere Idee, als ihn «Wodka» zu taufen. Das war wohl in etwa so gut gewählt, wie wenn ein Ex- Junkie seinen Goldfisch «Fixi» nennen würde.
Rytschkow tanzte in Basel eine Saison lang, dann beschloss er, die Sommerpause daheim in Irkutsk zu verbringen. Es gibt nur wenig Menschen, die ihre Heimat weniger gerne verlassen als Russen. Betrunkene Russen zum Beispiel. Oder betrunkene Russen, die während des Sich-Betrinkens eine Frau kennengelernt haben. Rytschkow gehörte im Sommer 1999 zur dritten Kategorie. Muntere 30 Tage nach Trainingsbeginn tauchte er erst wieder in Basel auf.
Dort hatte eben Christian Gross das Zepter übernommen. Und ein Trainer, den sie in London «Swiss Army Coach» genannt haben, steht nicht auf schwermütige Russen, die ihrer Heimat nachweinen. Rytschkow wurde für ein halbes Jahr nach Delémont abgeschoben. Als er danach für Weihnachten wieder nach Hause reiste, kam er gar nicht erst wieder zurück. Irgendwie hatte sich sein Abflug aus Moskau verzögert, der FCB löste den Vertrag per sofort auf.
Und Wodka? Der sass im Tierheim Basel, wo ihn Rytschkow vor Weihnachten abgegeben hatte. «Als er sich von seinem Büsi verabschiedete, weinte er bitterlich», recherchierte die «Basler Zeitung» danach knallhart. Die Rechnung von 2300 Franken bezahlte Rytschkow nie. Er versuchte sich noch ein paarmal im Westen als Profi, wobei er meist nach ein paar Spielen bereits wieder entlassen wurde. Seither kickt er zum Spass in seiner Heimatstadt Sibirskoye.
Wodka aber fand bald wieder ein neues Heim in Basel. Ganz in der Nähe des Stadions sogar. So wie es sich gehört für den Exkater eines Exfussballers.
103. Grund – Weil die ganze Stadt Basel in Châtel-St-Denis dabei war, offiziell aber nur 400 Zuschauer vermeldet wurden
Keine Frage: Der FC Basel hat das treuste Publikum westlich des Urals. Kein anderer Club konnte auch in seinen dunkelsten Stunden mehr auf seinen Anhang zählen als die Basler. Und solch dunkle Stunden bescherte der FCB seinen Fans in seiner Geschichte wahrlich zur Genüge. Aber jedes Tief ist ja auch eine Chance. Wie anders könnte eine Baslerin, ein Basler seine Treue besser unter Beweis stellen als mit dem Verweis auf jene Zeiten im tiefen Jammertal der Zweitklassigkeit? Und so kommt es, dass in den heutigen Zeiten des allgegenwärtigen Erfolgs unter dem rotblauen Anhang ein Gegner zu ganz besonderer Berühmtheit gelangt ist: Châtel-St- Denis. C H Â T E L – S T – D E N I S!
Dieses örtchen unweit des Genfersees mit heute rund 6000 Einwohnern ist der Inbegriff für ganz weit weg vom Duft der grossen, weiten Fussballwelt. Und es steht damit stellvertretend für die zahlreichen Tiefpunkte, die sich der FCB in seiner Zeit als mittelloser Fussballträumer leistete. Wer den FCB damals in der Nationalliga B sogar zu seinen beiden Auswärtspartien in Châtel-St-Denis begleitete, der ist Rotblau treuer ergeben als der Schäferhund seinem Frauchen. Anderswo würde das Bekenntnis, in ein reichlich bedeutungsloses Spiel der zweithöchsten Schweizer Spielklasse 340 Kilometer Fahrt und sieben Stunden seines Lebens investiert zu haben, sofort zum gut gemeinten Hinweis führen, man solle doch mal zu einem Treffen der Anonymen Fussballwahnsinnigen gehen: «Dort kann auch Ihnen geholfen werden!»
«Ich war ja auch in den schweren Stunden dabei, damals in Châtel-St-Denis.»
Aber weil Basel in diesem Fall tatsächlich anders tickt, entstand im Jahr 2002 zu Zeiten der ersten Qualifikation für die Champions League dieser eine Satz, der knallhart den echten vom Modefan trennte: «Ich war ja auch in den schweren Stunden dabei, damals in Châtel-St-Denis.» Wer sich unter den über 35-jährigen Basler Anhängern umhört, kann ihn noch heute hören.
Ja, damals in Châtel- St-Denis, da zeigte sich die wahre Kraft des FCB. Die halbe Stadt, ach was – die ganze Stadt war da, als die Basler bei ihrem zweiten Auftritt im Freiburgischen im August 1993 ein erschütterndes 1:1 hinmurksten. Etwas nur ist schade. Ganz offenbar waren die Menschen, die in Châtel-St-Denis für die Zählung der Fans zuständig waren, ob des Massenandrangs hoffnungslos überfordert. Oder wie sonst kommt es, dass im Telegramm jenes Spiels bloss 400 Zuschauer vermerkt sind?
Auf keinen Fall sollten wir dem nächsten Menschen misstrauen, der uns erzählt, wie er auch schon mit Haut und Haar Rot und Blau ergeben war, als noch keine Champions- League-Hymne in Basel ertönte und der FCB in Châtel … und so weiter und so fort. Denn wahrscheinlich waren sie wirklich alle dort – die einen vielleicht bloss in Gedanken und die anderen mit ihren Herzen. Aber das zählt doch irgendwie auch.
_
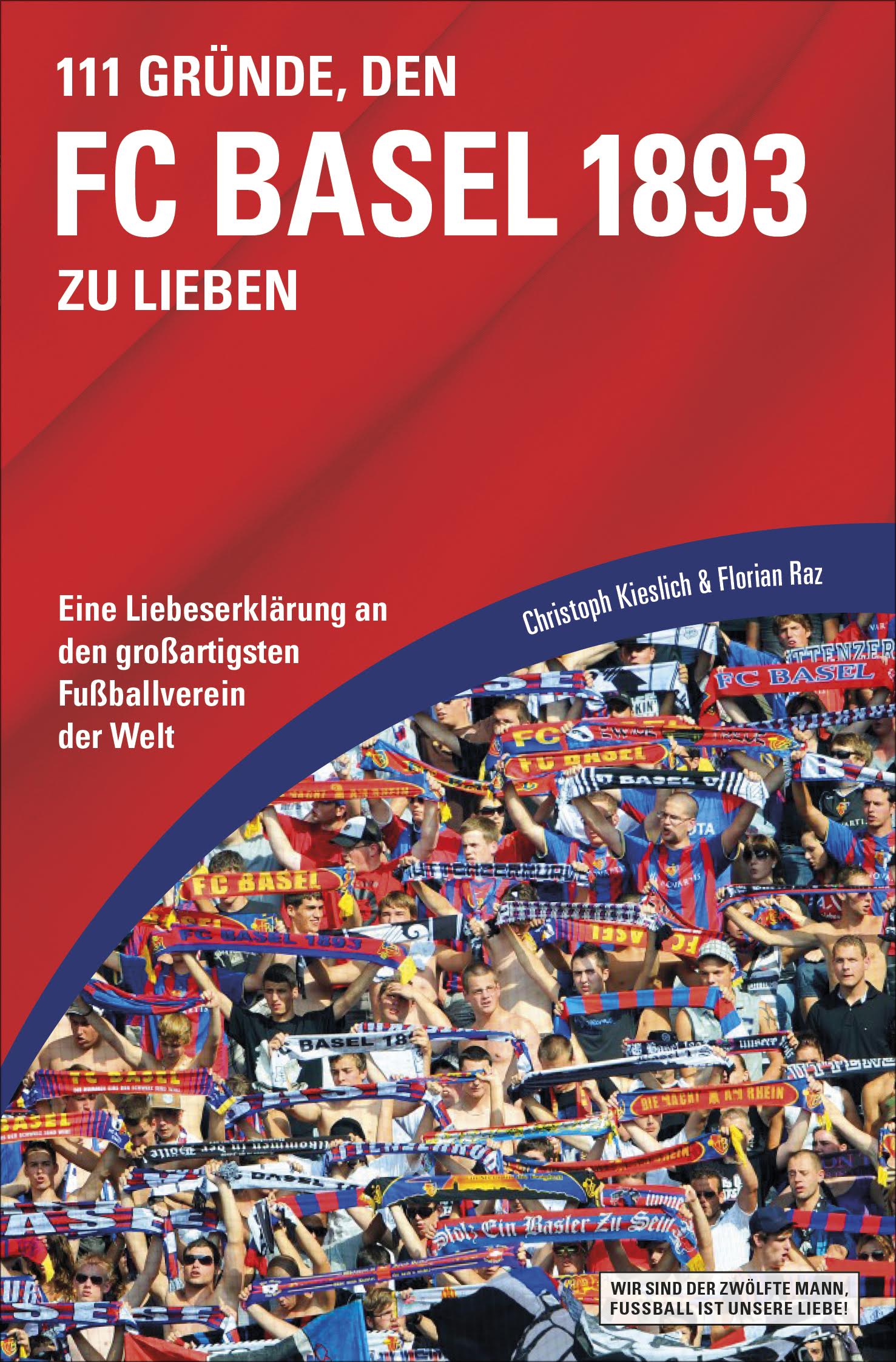
(Bild: Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag GmbH)
Das Buch von Christoph Kieslich und Florian Raz ist beim «Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag» erschienen, umfasst 304 Seiten und ist ab sofort im Handel erhältlich. Es kostet keine 111 Franken.
