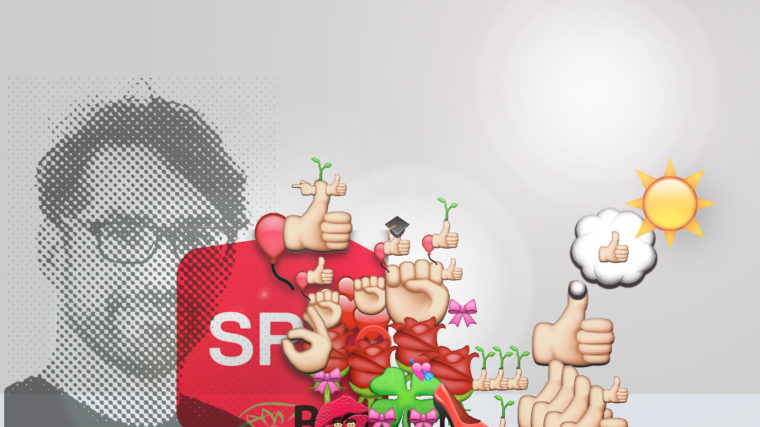Die TagesWoche beklagt in einem Kommentar, dass der Basler Politik die hohen Krankenkassenprämien herzlich egal seien. Das stimmt so nicht. Eine Replik.
Die TagesWoche thematisiert in ihrer ersten Augustausgabe die hohen Gesundheitskosten in Basel-Stadt und kommt zum Schluss, dass die Politik kapituliert habe. Ich bin für die SP-Fraktion seit 2015 Mitglied der Gesundheits- und Sozialkommission im Grossen Rat und ich kann in gewisser Weise nachvollziehen, dass man zu einem solchen Fazit kommen kann.
Ein paar Dinge muss man dazu aber schon noch sagen. Zum Beispiel, dass die SP-Fraktion im Frühjahr 2014 sieben Vorstösse zum Thema eingereicht hat (mehr dazu weiter unten). Wenn sich die Politik mit den Krankenkassenprämien beschäftigt, gilt es zu unterscheiden zwischen der Finanzierung der Gesundheitskosten (Sozialpolitik) und dem Wachstum der Gesundheitskosten an sich (Gesundheitspolitik).
Vorbildliche Prämienverbilligungen
Die Schweiz kennt bei den Krankenkassen für die Grundversicherung keine einkommensabhängigen, sondern kantonal unterschiedliche Kopfprämien. Gut Verdienende, Mittelstand und Arme zahlen alle denselben Betrag. Vielleicht sollten wir wieder mal versuchen, dies zu ändern.
Immerhin wurde das System der Prämienverbilligungen etabliert. Und da zeigt sich Basel-Stadt anders als von der TaWo dargestellt vorbildlich. Bis in den Mittelstand hinein erhielten Ende 2015 50’633 Personen oder 25,7 Prozent der Wohnbevölkerung einen Beitrag an ihre Krankenkassenprämien (insgesamt 185,4 Millionen Franken). Personen, die aufgrund ihrer aktuellen Steuerveranlagung einen Anspruch haben könnten, werden von Amtes wegen persönlich informiert.
Wollen wir Leistungen rationieren?
Nach der Finanzierung nun zu den Gesundheitskosten selbst. Es ist kein Geheimnis, dass ein grosser Teil der Kosten in den letzten zwei Lebensjahren anfällt. Die Fortschritte in der Medizin führen dazu, dass wir länger leben können, auch wenn das sehr teuer ist. Das grösste Sparpotential bestünde also darin, dass man gewisse Leistungen rationieren würde. Aber wollen wir wirklich, dass sich nur noch privat versicherte Reiche diese Massnahmen leisten können?
Dass Basel im schweizweiten Durchschnitt mehr Alte hat, schlägt sich in den Kosten nieder. Und das wird vorerst nicht besser. Baselland hat hier übrigens eine weitaus grössere demografische Herausforderung vor sich.
Spezialärzte profitieren auf Kosten der Prämienzahler
Bürgerliche Gesundheitspolitiker setzen auf Wettbewerb im Gesundheitswesen. Sie sind damit noch nicht vollständig durchmarschiert, aber sie haben es weit gebracht. Dabei konstatiert die TagesWoche zu Recht, dass seit der Markt spielt, die Kosten noch stärker steigen. Die Hoffnung, dass die Einführung der Fallpauschalen zu Einsparungen führe, hat sich nicht erfüllt. Irgendwo müssen die Profite der Privatspitäler ja herkommen.
Allerdings sind in Basel-Stadt die meisten Privatspitäler nicht profitorientiert, sondern gemeinnützig. Ein Spitalmanager hat es mal so formuliert: Die Privatspitäler dienen nicht ihrem eigenen, sondern dem Profit ihrer Ärzte. Eine andere Gruppe, die vom heutigen System profitiert und die Kosten treibt, sind die in Basel überdurchschnittlich vertretenen Spezialärzte in ihren privaten Praxen. Es wäre schon viel gewonnen, wenn die Patienten sich durch ihren Hausarzt abklären liessen, bevor sie zum viel teureren Spezialarzt oder gar direkt ins Spital gingen.
Vorstösse der SP scheitern an bürgerlicher Mehrheit
Die SP-Grossrätin Sarah Wyss hat im Rahmen des eingangs erwähnten Vorstosspaketes verlangt, dass Regierungsrat Engelberger hier steuernd eingreift und Massnahmen gegen das Überangebot vorlegt. Dieser Vorstoss wurde aber von den vereinigten Bürgerlichen von GLP bis SVP am 18. März 2015 im Grossen Rat versenkt.
Das gleiche Schicksal ereilte den Vorstoss von Jürg Meyer, welcher in Zusammenarbeit mit ihren Organisationen die Gesundheitsvorsorge unter Migranten verstärken wollte. Da stimmten immerhin eine CVP-Frau und ein FDPler mit Migrationshintergrund zu. Die SP und das Grüne Bündnis standen allein auf weiter Flur.
Einen Lichtblick kann ich wenigstens vermelden. Salome Hofers Vorstoss zur Information der Bevölkerung über Hausarztmodelle liegt mit der Frist vom 11. März 2017 zur Beantwortung beim Gesundheitsdirektor. In einem eigenen Bericht geht die Regierung von einer möglichen Kostenersparnis bis zu 30 Prozent aus, wenn die Hausärzte gegenüber Spezialärzten und Notfallaufnahmen der Spitäler gestärkt werden. Ich befürchte, dass es hier bei freiwilligen und selbstverantwortlichen Lösungsvorschlägen bleiben wird. Für wirksamere Massnahmen wie eine Zulassungsbeschränkung der Spezialärzte und eine striktere Kontrolle der Spitäler bräuchten wir halt in Gottes Namen andere Mehrheitsverhältnisse im Grossen Rat.
Weber und Engelberger stehen in der Pflicht
Der CVP-Regierungsrat Engelberger selbst sieht die Chance für ein Bremsen des Kostenwachstums vor allem in der Fusion des Unispitals mit dem Kantonsspital Baselland. Die SP Basel-Stadt hat sich bereits früh konstruktiv zu diesem Vorhaben geäussert und begrüsste die offene Diskussion über die Zukunft der Gesundheitsversorgung in beiden Basel, weil eine gemeinsame Planung absolut Sinn macht. Auch wenn bisher noch keine Details bekannt wurden, stehen wir dem Projekt grundsätzlich positiv gegenüber, wenn damit weiterhin eine gute Versorgung für alle gewährleistet ist.
Entscheidender als die Spitalfusion wird aber sein, dass die Spitallisten der beiden Basel koordiniert werden und damit die Angebotssteuerung interkantonal geregelt wird, wie dies ein überwiesener Vorstoss der grünen Grossrätin Nora Bertschi fordert (Frist für Regierungsantwort 11.11.2016). Dafür müssen die beiden zuständigen Regierungsgräte ihre Scheu vor Eingriffen in den ausufernden Wettbewerb ablegen.