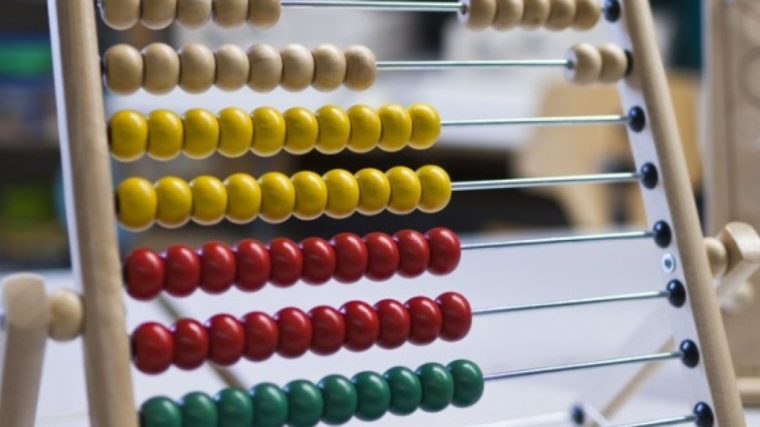Der SVP ist im Nationalrat noch stärker vertreten als es ihrem Wähleranteil entspricht: Ihre 65 Sitze entsprechen 32,5 Prozent der 200 Sitze, ihr Wähleranteil beträgt 29,4 Prozent. Nicht nur strategisches Geschick, sondern auch Glück bringt Sitze.
Der Wähleranteil gemäss den Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) und der Sitzanteil im Rat unterscheiden sich um 3,1 Prozentpunkte. Diese Differenz ist bei der SVP – der Wahlsiegerin vom Wochenende – unter allen Parteien am grössten.
SP: Mehr Wähleranteil, weniger Mandate
Die SVP hatte seit 1971 noch nie so stark vom Proporz profitiert wie 2015. Wie das System spielen kann, zeigt das Beispiel SP: Die Sozialdemokraten sicherten sich 2011 mit 18,7 Prozent Wähleranteil 46 Sitze im Nationalrat. Damals lag die Differenz zwischen Sitzanteil und Wähleranteil bei 4,3 Prozentpunkten.
Am Wochenende hat die SP zwar drei Sitze verloren, gleichzeitig laut BFS aber den Wähleranteil von 18,7 auf 18,8 Prozent gesteigert. Ihre neu noch 43 Sitze entsprechen immerhin noch 21,5 Prozent der Mandate im Nationalrat.
Noch 1,9 Punkte beträgt die Differenz bei der CVP: Mit einem Wähleranteil von 11,6 Prozent kommt sie auf einen Sitzanteil im Parlament von 13,5 Prozent. Bei der FDP entspricht der Wähleranteil praktisch dem Sitzanteil im Nationalrat. Sie hat 16,4 Prozent der Stimmen erhalten und kommt auf einen Sitzanteil von 16,5 Prozent.
Wo Gewinner, da Verlierer
Wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. Erwischt hat es die Grünliberalen, die am Wochenende fünf ihrer zwölf Mandate im Nationalrat verloren und einen Wähleranteil von noch 4,6 Prozent haben. Ihre sieben Mandate entsprechen einem Stimmenanteil im Rat von noch 3,5 Prozent.
Ebenfalls sieben Mandate hat die geschrumpfte BDP. Doch nur 4,1 Prozent der Wählenden entschieden sich am Wochenende für die BDP. Anders war es vor vier Jahren: Mit je 5,4 Prozent Wähleranteil erreichte die GLP einen Mandatsanteil von 6 Prozent – das entspricht zwölf Sitzen – und die BDP einen Mandatsanteil von 4,5 Prozent.
Den grössten Nachteil vom System hatten am Wochenende jedoch die Grünen: Sie erreichen mit einem Wähleranteil von 7,1 Prozent einen Mandatsanteil von 5,5 Prozent. Die EVP schliesslich brachte es auf einen Wähleranteil von 1,9 Prozent. Ihre zwei Mandate im Nationalrat entsprechen einem Stimmenanteil von gerade einem Prozent.
Ungleichheiten im Wahlrecht
Das Wahlrecht führt zu Ungleichheiten: «Vor allem grosse Parteien profitieren», sagt der Politologe Daniel Bochsler vom Zentrum für Demokratie Aarau. Grund sei das Rundungsprinzip in den 20 Kantonen, in denen nach Proporz gewählt wird. Bei der Zuteilung der in der ersten Verteilrunde «verlorenen» Sitze seien grosse Parteien im Vorteil gegenüber mittelgrossen und kleineren.
Ein Problem ist laut Bochsler, dass dieses System in jedem der 20 Proporzkantone für sich angewandt werde. «Eine Partei kann damit 20 Mal profitieren oder 20 Mal verlieren.» Einen Systemwechsel, der kleinere Parteien besser berücksichtigen würde, müsste laut Bochsler das Parlament beschliessen.
Das System allein sorgt aber nicht dafür, dass eine Partei im Nationalrat stärker vertreten ist als es ihrem Wähleranteil entspricht. Einfluss hat auch die Strategie bei Listenverbindungen, wie Bochsler sagt. «Um die beiden Faktoren auseinanderzudividieren, braucht es in jedem Kanton aber zusätzliche Auswertungen.»
Opfer des eigenen Erfolges
Wie viel Zufall und wie viel Geschick im Spiel war bei der BDP, die vor allem in den Stammlanden Bern und Graubünden viele Stimmen verloren und doch nur zwei ihrer neun Nationalratssitze eingebüsst hat, ist offen. «2011 hielt sich die BDP mit Listenverbindungen zurück. Dieses Mal ist sie strategisch bessere Listenverbindungen eingegangen», sagt Bochsler.
Möglicherweise habe die BDP damit Mandate halten können. Eine Listenverbindung alleine rettet einen Sitz aber nicht: «Die Grünliberalen verdankten 2011 die Hälfte ihrer damals zwölf Sitze Listenverbindungen», sagt Bochsler. Seit dem Wochenende seien es nun noch sieben Sitze, trotz immer noch starker Verbindungen.
Die Grünliberalen seien auch Opfer ihres Erfolges von vor vier Jahren geworden, sagt der Politologe. Andere Parteien hätten gesehen, wie sich gute Listenverbindungen auszahlten und ihre Strategien angepasst.