Zum ersten Mal ist Dominik Grafs filmisches Werk umfassend zu sehen. Erstaunlich wenig werden dabei seine besonders gelobten Polizeifilme vertreten sein. Dafür sind auch seine frühen Perlen zu entdecken.
Festlegen lässt er sich nicht. Dominik Graf ist genauso unberechenbar, wie er ein Altmeister ist. Im Februar zeigte er an der Berlinale «Die geliebten Schwestern», einen dreistündigen Briefroman aus der Zeit Schillers. Damals wagte das Bürgertum von der Revolution zu träumen. Graf choreografiert die Wendezeit der Liebesideale, schildert ein Dreiecksverhältnis von Friedrich mit den beiden Schwestern von Lengefeld – einen Beziehungsdiskurs, wie er es nennt. Auf der anderen Seite dokumentiert Graf in «Es werde Stadt!», seinem neuesten Film, die Utopie und den langsamen Tod der Plan-Wohn-Stadt Marl, die nie einen eigenen Herzschlag entwickelt hat. Ironischerweise wird in dieser Stadt jährlich der Adolf-Grimme-Preis für herausragende Fernsehleistungen verliehen, den Graf selber zehn Mal gewonnen hat.
Graf ist wie keiner in Deutschland ein Regiefacharbeiter. Doch bei aller Routine hat er den Traum nie aufgegeben, dass Qualitätsfilm in der Fernsehlandschaft eine wichtigere Rolle spielt.
Zum ersten Mal wird nun im Stadtkino Basel sein Werk umfassend im Kino zu sehen sein. Zwar werden dabei seine besonders gelobten Polizeifilme erstaunlich wenig vertreten sein. Dafür sind auch seine frühen Perlen zu sehen. Im April ist nicht nur ein reizvoller Querschnitt durch sein Schaffen zu sehen, Graf wird auch für ein Wochenende in Basel sein, vom 11. bis zum 13. April, in der gewohnt vertraulich trauten Atmosphäre des Stadtkinos.
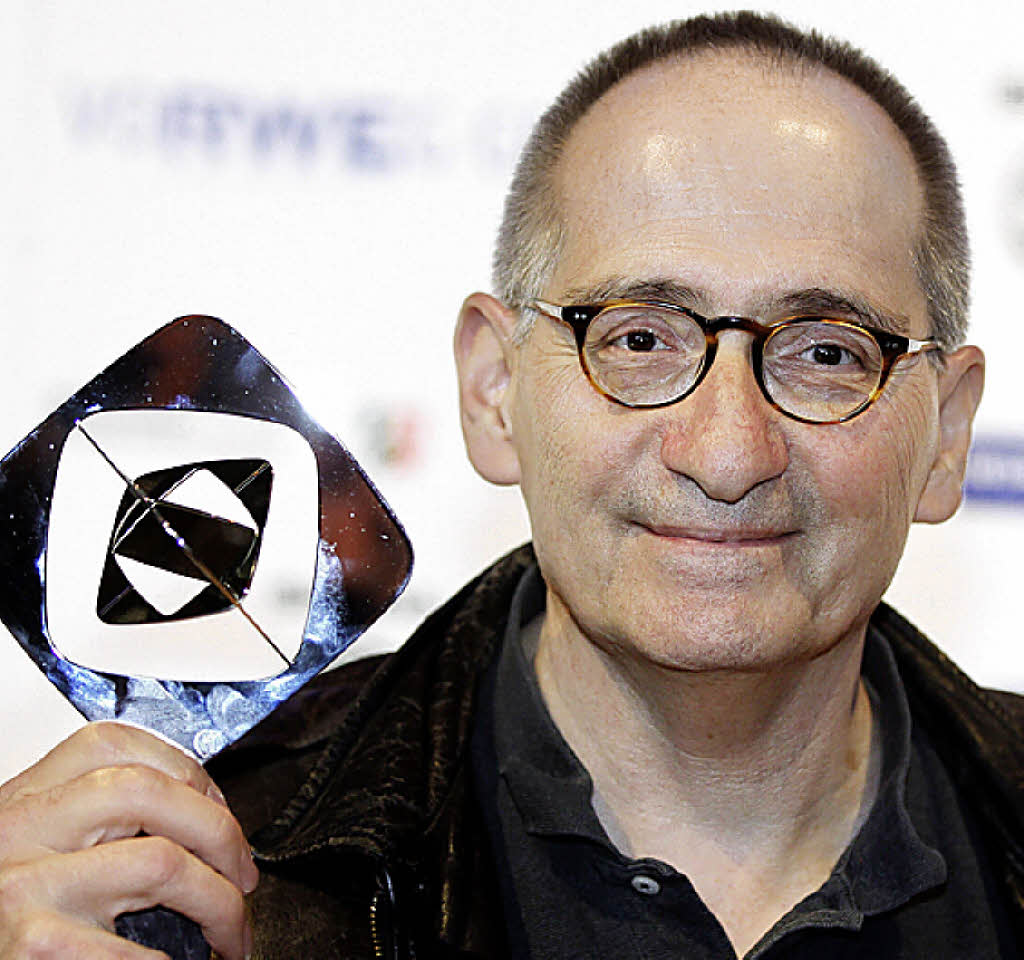
Dominik Graf mit seinem neunten Grimmepreis im Jahr 2011.
Herr Graf, das Stadtkino zeigt in Basel einen Überblick über Ihr OEuvre. Welches ist Ihr Lieblingsfilm im Programm?
Jeder meiner Filme hatte bei mir einmal das Zeug zum Lieblingsfilm. Aber ich entwickle mich ja immer weiter – übrigens auch in überraschende Richtungen. Es ist immer wieder ein anderer. Ich weiss es nicht.
Oft kommen in Ihren Filmen Verbrechen vor. Ist die Verfolgung von Verbrechen das gültige Abbild unserer Gesellschaft?
Mich interessieren Filme, in denen ein Apparat, der auf Gerechtigkeit und Gesetzestreue ausgelegt ist, sich mit der Zeit und der Gesellschaft auseinandersetzen muss. Die einzelnen Menschen in diesem Apparat müssen im Apparat handeln, aber auch gegen den Apparat. Sie sind Teil eines Systems, das sich im Moment Demokratie nennt. Für meine Polizeifilme recherchiere ich immer neu in dieser Realität. Sie setzen wie ein Skalpell an und legen frei, was die Gesellschaft daran hindert, gesund zu sein.
Welches sind die Verbrechen, die noch auf Ihre Verfilmung warten?
Ich nehme in meiner Generation an einem grossen Wandel teil. Ich werde sicher noch einmal auf die Geschichte des Terrorismus zurückkommen. Ich habe aber noch kein ausgereiftes Projekt. Ich kann in diesem Stadium noch nicht darüber reden. Kommt noch ein Aberglaube dazu: Immer wenn ich über ein Projekt zu früh geredet habe, ist es nicht zustande gekommen.
Haben Sie selbst auch schon als Schauspieler gearbeitet?
Ja. Das war damals, um Geld zu verdienen. Selber spielen ist ein wichtige Erfahrung. Das kann man sich nicht vermitteln, man muss es erleben. Es war wichtig, um den Umgang mit Schauspielern zu lernen. Auch wenn ich selber aus einer Schauspielerfamilie komme.
Sie haben einen Dokumentarfilm über Marl gedreht. Darin wird eine Stadt als Utopie entworfen und endet als trostlose Agglomeration. Warum stossen Sie immer wieder auf diese verlorenen Utopien?
Ich arbeite in ihnen. Zu den Utopien der Bundesrepublik, die alle nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, gehört das öffentlich rechtliche Fernsehen genauso wie das Bauen von Retortenstädten, in denen Grossstädte als soziale Zentren imitiert werden.
Man kann die Stadt, deren Entwicklung Sie porträtieren, als eine Metapher für eine gescheiterte Fernseh-Utopie verstehen?
Genau. Von den Träumen und Hoffnungen, die mit der Stadt verbunden wurden, verabschiedete man sich Stück für Stück. Die Kriterien von Wettbewerb und Nützlichkeit bringen Utopien zu Fall. Auf ähnliche Weise wird die Produktion von TV-Filmen durch kapitalistisches Denken massakriert. Fernsehen schielt auf Quote, auch im Film.
Das Fernsehen verkauft sich. Ist dafür das Kino in Gefahr?
Die Digitalisierung des Films ändert viel. Aber die Kinos werden überleben. Kino hat schon mehr überlebt als nur eine blosse technologische Entwicklung.
Wohin führt die technologische Entwicklung den Film?
Ich werde mich in der Digitalisierung nicht mehr zurechtfinden. Ich will weiter auf Film drehen, solange es nur geht. 35 Millimeter, wenns sein muss. Mit Film kann ich sehen, was ich kriege. Digital sitze ich monatelang vor einer grünen Sosse, die dann erst noch nachbearbeitet werden muss. Mich interessiert die Realität. Das, was ich antreffe. Ich will «das bisschen Realität, das ich brauche», wie einst Fassbinder gesagt hat. Oder wie Renoir es forderte: «Man muss der Wirklichkeit die Türe offen lassen, damit sie hereinkommen kann.»
Heisst dass, der digitale Film hat nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun?
Die Wirklichkeit wird aus den Filmen verbannt. Dabei sind Fehler oft die interessantesten Dinge in einem Film. Die können jetzt alle ausgemerzt werden. Das ist nicht meine Art.
Können die Fernsehstationen da noch eine Nische offen halten?
Kaum. Das ist vor allem in einer Hinsicht verheerend: Digitiale Datenträger haben eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren. Die Sender zwingen nun die Produzenten, die Filme auch auf 35 Millimeter zu kopieren. Weil die merken, dass sie sonst alle fünf Jahre neu digitalisieren müssen. Dauerhaft ist vorerst nur der gute alte Film.
Ich versuche, meiner Utopie treu zu bleiben.
Sie interessieren sich besonders für Stoffe aus der Vergangenheit. Warum?
Obwohl ich mich gerne den Utopien der Gegenwart stelle, finde ich im Denken der Menschen aus vergangenen Zeiten, etwa bei Schiller, etwas Weitergehendes. Ich kann nicht beurteilen, ob seine Briefe heutiges SMS-Denken überflügeln. Wer wäre ich denn, wenn ich das beurteilen könnte. Aber ich schätze an Schiller sehr, dass er eine Sprachgewalt entwickelt hat, um über seine Gefühle nachzudenken. Die findet man heute so nicht.
Schiller lebte in der Utopie, die Menschheit könnte sich zum Besseren hin entwickeln…
Nicht nur das: Er stand selber dafür. Wenn Sie seine Briefe lesen, als ob es Dialoge wären, dann entstehen seine Sätze ganz neu. Ich hatte beim Schreiben des Drehbuches plötzlich das Gefühl, wenn ich ganze Absätze dieser Briefe dialogisiere, dann werden sie plötzlich knapp wie ein Telefongespräch. Oder wie ein Dialog per SMS.
Am Theater kennen wir Schiller kaum unter drei Stunden. Warum wird auch Ihr Schiller-Film so viel Zeit in Anspruch nehmen?
Sie werden in Basel so etwas wie den «Director’s Cut» sehen, den wir auch in Berlin gezeigt haben. Ich habe die Länge bestehen lassen, weil ich das Gefühl der vergehenden Zeit auch auf eine andere Art erlebbar machen wollte: Die Träume, die Liebe, der Alltag, die Familie gehen durch eine tiefgreifende Veränderung. Was bliebe sonst von den vierzehn Jahren Lebenszeit, von denen der Film handelt? Die Geschichte darf in den 170 Minuten all ihre Verwinkelungen ausleben.
Sie haben in «Denk ich an Deutschland – Das Wispern im Berg der Dinge» Ihren Vater porträtiert, als Sie selber schon als Schauspieler oder Regisseur viel Erfahrung hatten.
Da hat mich die Vergangenheit in einer ganz anderen Art eingeholt: Ich merkte zu dieser Zeit, dass ich älter geworden war, als mein Vater je war. Das hat mich so schockiert, dass ich seinem Leben auf die Spur kommen wollte. Ich hatte das Gefühl, nicht nur Neues zu entdecken, sondern eben auch die eigene Vergangenheit. Oder besser: die eigene Vergänglichkeit.
Sie sind einer der produktivsten und doch einer der unangepasstesten Filmemacher, den das deutsche Fernsehen kennt. Was können Sie davon als Dozent weitergeben?
Ich versuche meiner Utopie treu zu bleiben. Ich mache zum Beispiel keinen Unterschied zwischen Kino- und Fernsehfilm. Die kleinen Fernsehfilme, die ich mache, mache ich mit weniger Geld und Zeit. Aber ich versuche mich darin zu finden wie in einem grossen Kinofilm. Jeder Film soll zeigen, was das Medium kann. Mich interessieren der Polizeifilm ebenso wie Filme zum Beziehungsdiskurs. Die beiden Genres begleiten mich seit ich angefangen habe, mich mit Film zu beschäftigen.
«Das Gelübde»: Die Nonne begegnet Clemens Brentano
Wie geben Sie das Ihren Studenten mit auf den Weg?
Ich kann da immer nur meinen eigenen Weg sichtbar machen. Ich bin vielleicht rabiat, ich bin kompromisslos für das Genre. Ich versuche nicht, politisch korrekt zu sein. Zu den smarten Wegen, die Filmförderung heute erfordert, kann ich nicht viel sagen.
Ihre Filme zeichnen sich immer durch Widerspruchsgeist gegen das Bestehende aus. Finden Sie das auch bei Studierenden wieder?
Ich bin nicht in den Widerstand geboren. Ich habe ihn in der Begegnung mit dem System entwickelt. Man kann niemanden auf Regisseur polen. Regisseure sind aber nicht nur Schauspielbetreuer. Es sind vor allem Organisatoren von Abläufen, die zu Bildern führen sollen. All dies versuche ich weiterzugeben.
_
Dominik Graf ist während der Werkschau vom 11. bis 13. April im Stadtkino anwesend.
