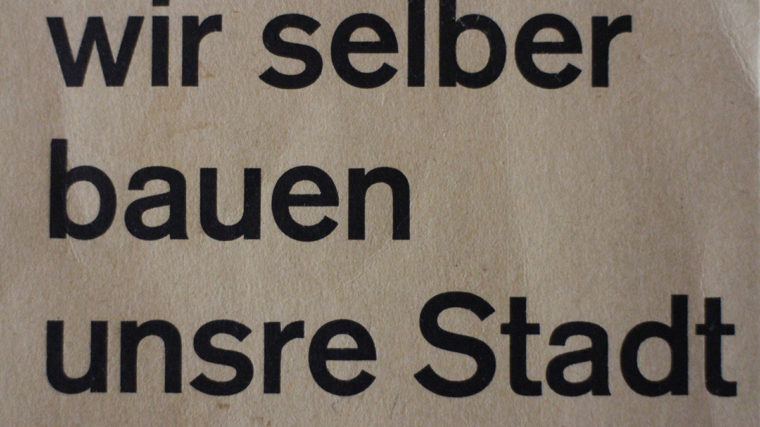Die Kleinstadt Basel befindet sich im Wandel. Seit dem zweiten Millenium verändert sie ihr Gesicht fast täglich. Ein Turm nach dem anderen schiesst aus dem Boden und Visionen, gerne auch «Visualisierungen» genannt, häufen sich zunehmend. Aber wo führt das alles hin? Eine Frage, die sich zwei bekannte Basler schon in den fünfziger Jahren gestellt haben.
Vor über fünfzig Jahren machten sich zwei junge Basler Gedanken über die Planung und Entwicklung des urbanen Raums. Sie veröffentlichten ihre Reflexionen in einem kleinen Büchlein, das den Titel «Wir selber bauen unsre Stadt» (1953) trägt. Aber wer sind die beiden? Es handelt sich um Lucius Burckhardt und Markus Kutter. Beide aus erhabenen Basler Kreisen.
In ihrem Büchlein finden sich zahlreiche Überlegungen zu städtischen Fragen. Unter anderem zur Partizipation in Planungsfragen, zur (ja auch damals schon diskutierten) Hochhausdebatte oder zur künftigen Entwicklung der Stadt. Im Sinne des Letzteren fragten sich Kutter und Burckhardt:
«Wie nun, wenn es sich nicht mehr um individuelle Interpretationen, sondern um Vorstellungen bezüglich einer ganzen Stadt handelt?»
Auf diese sich an die Gesamtheit richtende Frage antworteten sie gleich im nächsten Satz:
«Es lässt sich denken, dass sich eine ganze Stadt in einer bestimmten Richtung falsch interpretiert; sei es, dass sie sich an einer Grossstadtvision übernimmt, oder dass sie im Gegenteil in romantischer Vorstellung den Dorfcharakter zu lange beibehält.»
Der springende Punkt, auf den die beiden hinauswollten, war eine Vorstellung zu haben, wie sich eine Stadt – sie nannten oft Basel – künftig entwickeln wird oder nicht. Auch wenn sie diese Worte in den fünfziger Jahren aufs Papier brachten, so sind sie heute immer noch aktuell. Doch wie lassen sie sich nun ein halbes Jahrhundert später in Bezug auf Basel interpretieren? Fragen wir uns nicht auch, ob wir wirklich noch in derselben Stadt sind, wenn wir von der Messe in Richtung Spalenberg spazieren?
Messeturm frisst Cliquenkeller
Die Stadt im Rheinknie mit ihren rund 170’000 Einwohnerinnen und Einwohnern zählt im schweizerischen Vergleich zu den Grossstädten – wie Zürich oder Genf. Dieselbe Stadt mit den denselben Einwohnerinnen und Einwohnern ist aber ein winziges Städtchen im weltweiten Vergleich. Mittlerweile kommt zunehmend der Verdacht auf, dass sich Basel gerne in Richtung Grossstadt des zweiten Typs entwickeln möchte. Denn die Bauwut ist riesig in Basel. Dass hier ebenso schnell und rigoros Entscheidungen für Neubauten fallen, sei hier mal aussen vorgelassen. Aber wo geht die Reise hin?
Auch heute, über fünfzig Jahre nach der Publikation der beiden Basler, fragen wir uns doch auch wieder, wo wir hingehen: in Richtung Grossstadt oder in Richtung der Bewahrung des Dorfcharakters? Zwei Szenarien, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Vielleicht bietet ein Blick auf künftige Bauten eine angemessene Antwort auf diese Frage.
Die Prise Stolz beim Bau
Modern heisst hoch und bedeutet «verdichten». Das heisst wiederum mehr bauen. So – könnte man meinen – lautet das neue Leitbild der Politik und Planung. Seit der Annahme der Revision des Raumplanungsgesetzes am 3. März 2013 meinen die grösseren Städte der Schweiz, mit ihrem nächsten Bau den Himmel erreichen zu müssen. Denn jetzt soll es eng werden, also los, wir bauen in die Höhe.
Hinzu kommt dann noch eine Prise Stolz sowie das Konkurrenzdenken. Basel hat den Messeturm, kurz darauf übertrumpft Zürich mit dem Prime Tower. Das lässt sich Basel sicher nicht gefallen – und bald hat es den Roche-Turm. Aber das ist noch nicht genug. Am besten verfestigt man die Position mit einem Claraturm. Doch ist das wirklich genug? Nein, am besten noch ein Hochhausviertel, welches die Planung im Jahre 2010 unter dem Namen «New Basel» vorstellte und heute als «Rheinhattan» bekannt ist. Inwiefern sich die Antwort «Grossstadtvision» hier noch ausschliessen lassen würde, wäre schleierhaft. So ist der Wolkenkratzer mit Sicherheit nicht das einzige, aber das mit den Augen wahrnehmbare Symbol von Grossstädten schlechthin.
Neoliberale Ausrichtung von Politik und Planung, wie in Basel am Beispiel Novartis zu Genüge gezeigt, lassen die von Burckhardt und Kutter diskutierte Variante «Dorfcharakter» in den Hintergrund rücken. Die Grossstadt frisst das Vertraute, Heimelige und Dörfliche auf und tritt – wenn auch nicht wirklich in absehbarer Zeit – dem Kreis der internationalen Metropolen bei. So wie Markus Kutter und Lucius Burckhardt schon schrieben, dass eine Grossstadtvision «übernommen wird», so lässt dies vermuten, dass etwas Vorhandenes verloren gehen muss – das vertraute Basel.
Wohnen im Museum
Das Turmszenario leitet über zum entgegengesetzten Szenario: «Dorfcharakter bewahren». Das Neue und Moderne findet im rot-grünen Basel etliche Befürwortende, aber auch ebenso viele verwerfende Stimmen. Die Haltung «etwas Neues gleich abzulehnen», das gefällt vielen. Das Wort Hochhaus in den Mund zunehmen, schon alleine das ist mittlerweile ein Verbrechen.
Basel soll sich bewahren, ein Museum bleiben. Weiterentwicklungen und Mut zu Neuem stehen nicht auf der Rechnung vieler Bewohnerinnen und Bewohner. Dabei haben doch der Ausbau der Pharmagiganten auch viele Arbeitsplätze generieren können. Und der Claraturm sowie auch die geplante Überbauung auf der Klybeckinsel steigern die Attraktivität Basels. Das erhöht den Standortfaktor der Stadt und zieht wiederum neue Unternehmen mit weiteren Arbeitsplätzen an. Der Widerstand gegen solche Unternehmungen vergrössert sich von Tag zu Tag – die Fronten verhärten sich.
Turm zu Babel – auch der ist eingestürzt
Wo sich Markus Kutter und Lucius Burckhardt vielleicht in den Fünfzigern ein wenig uneinig waren, dort trifft dies auch heute noch zu. Wo wollen wir hin? Nach vorne oder zurück? Nimmt man die städtebauliche Entwicklung Basels unter die Lupe, so lässt sich unschwer erkennen: es geht nach vorne in Richtung Grossstadt. Die Zahl der in den Himmel ragenden Projekte nimmt zu.
Als Rechtfertigung dient die Verkleinerung der Bauflächen durch die Raumplanungsgesetzesrevision. Doch hat sich da das Volk wirklich selbst geschnitten? Wer unter Verdichtung den dichteren Baubestand sieht, die oder der sicherlich. Wenn unter dem aufkommenden Schlachtruf «Verdichtung» die Wohnformen gemeint sind, so vielleicht eher nicht. Die Verdichtung mit Hochbauten zu lösen ist Irrsinn. Eher sollten wir uns Gedanken über künftige Wohnformen machen.
Braucht ein Singlehaushalt über 100 Quadratmeter Wohnfläche und vier Zimmer? Und nicht zu vergessen, etwa die Hälfte aller Haushalte in Basel sind von Singles organisiert (Statistisches Amt Basel-Stadt). Irgendwann geht etwas nicht mehr auf. Die Zahl der leerstehenden Wohnungen nimmt ab, aber der Flächenverbrauch pro Person nimmt zu. Ist das modern?
Fasnacht in Manhattan
Ob Grossstadt oder romantischer Dorfcharakter – es ist vielleicht doch noch etwas ungewiss, wo die Reise hinführt. So sind auch wir nicht viel weiter als damals Lucius Burckhardt und Markus Kutter. Graben wir aber etwas tiefer und reflektieren auf dialektische Art und Weise, wie es auch die beiden taten, so lässt sich der Trend «weg vom Dorfcharakter» schrittweise erahnen. Interessant wäre auch zu wissen, was die beiden wohl zum heutigen hochhausfanatischen Städtebau sagen würden. Ob sich ihre Meinung seit den Fünfzigern verändert hätte?
«Verfolgt man aber Schriften moderner Stadtplaner und auch die tatsächlichen Vorgänge in neu wachsenden Grossstädten, so zeigt sich, dass die Stadtkerne mit nebeneinander stehenden Wolkenkratzern eigentlich einer vergangenen Epoche angehören, und – abgesehen von besonderen Umständen – im allgemeinen mehr den Ausdruck einer Fehllenkung oder einer überhaupt fehlenden Lenkung darstellen, jedenfalls aber weder unausweichlich noch wünschenswert sind.»
Vielleicht bestünde aber noch die Möglichkeit, die von den beiden Baslern angesprochene «Falschinterpretation» zu umgehen. Die Fasnacht wäre wohl in einem zweiten Manhattan beziehungsweise «Rheinhattan» kaum wiederzuerkennen.
(Buchquelle: Kutter, Markus & Burckhardt, Lucius (1953): Wir selber bauen unsere Stadt. Basel: Handschin.)