Review zu „Wer bin ich, wenn ich online bin … und was macht mein Gehirn solange?“ von Niolas Carr (2010) //
Der griechische Philosoph warnte einst vor der Schrift: Das Niederschreiben von Gedanken schade dem menschlichen Gedächtnis. Nicolas Carr – der Autor des heute vorgestellten Buches – glaubt, dass diese Vorhersage nicht falsch war, sondern einfach verfrüht: Nicht die Schrift ist der Feind unseres Gedächtnisses, sonder das Internet. Im Internetzeitalter lesen wir oberflächlicher, lernen schlechter, erinnern uns schwächer. Von den Anpassungsleistungen unseres Gehirns profitieren nicht wir, sondern die Konzerne, die mit Klickzahlen Kasse machen. Kann sich die digitale Gesellschaft nicht mehr konzentrieren? Macht uns das Internet oder Google tatsächlich dumm? Was aber ist mit all den positiven Auswirkungen, die dieser „kognitive Überschuss“, wie ihn Clay Shirky, in gewisser Hinsicht Carrs Antagonist, nennt, auf uns, die Gesellschaft, und schliesslich die ganze Welt hat?
Prof. Dr. Simanowski beantwortet die acht Fragen zum Buch von Niolas Carr „Wer bin ich, wenn ich online bin … und was macht mein Gehirn solange?“
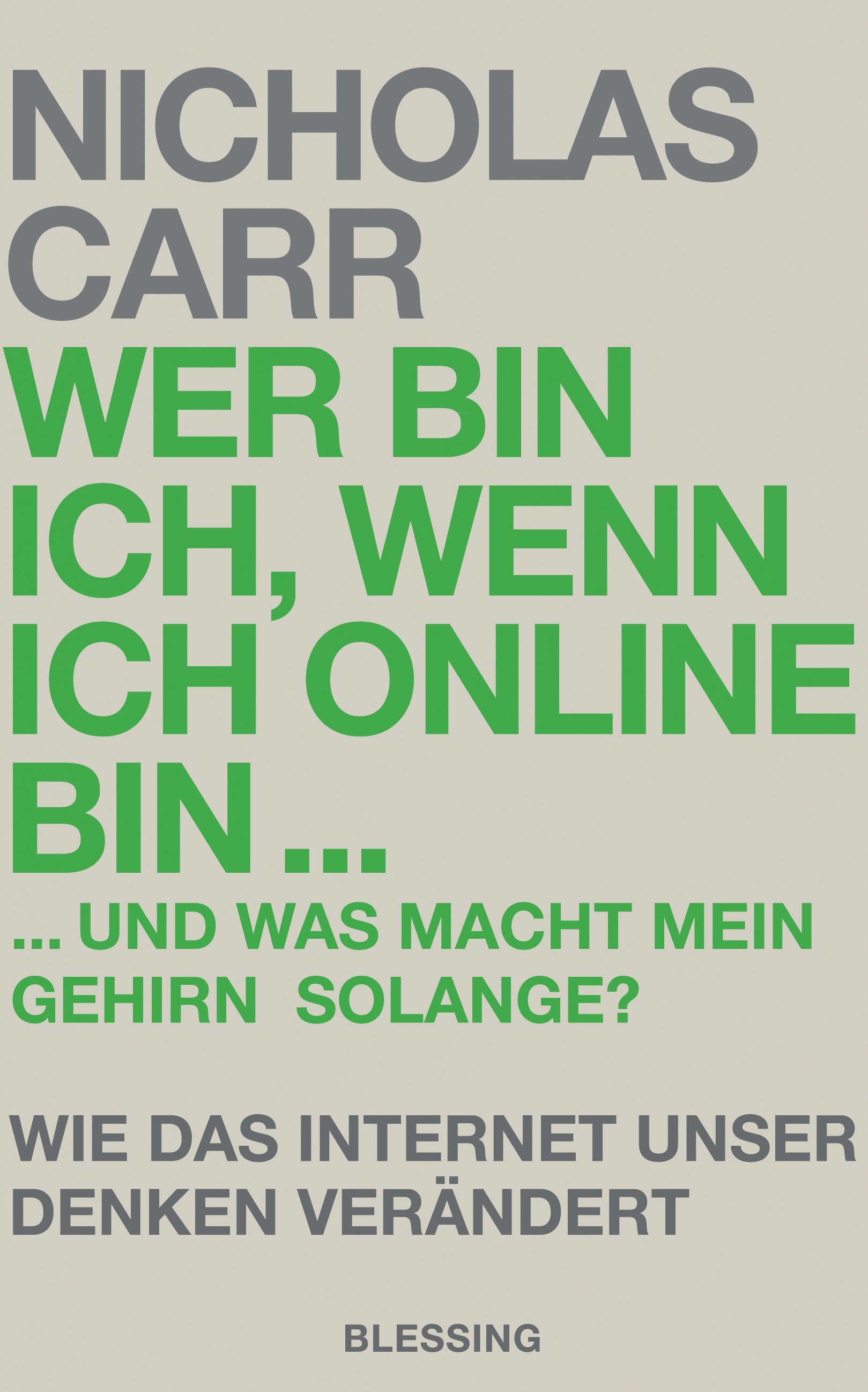
(Bild: x)
Wovon handelt das Buch? Vom Ende des Gutenbergzeitalters. Aber nicht, weil es keine Bücher mehr gäbe, sondern weil das Lesen am Bildschirm das Lesen an sich ruiniert.
Inwiefern? Das Multitasking-Modell des Computers verdrängt die Fähigkeit zur konzentrierten Lektüre durch die Sehnsucht nach Ablenkung. Nach zwei, drei Seiten schaut man unruhig ins Email-Programm oder aufs Handy, ob Nachrichten eingegangen sind. Das hat ernsthafte neurologische Konsequenzen, wie die Hirnforscherin Maryanne Wolf in ihrem Buch Das lesende Gehirn (2009) warnt: Ohne „deep reading“ kein „deep thinking“.
Ist das Carrs zentrale These? Für Carr führt die Struktur des Internet zu Konzentrationsschwäche und Intelligenzschwund. Das hyperaktive Hin- und Her-Springen zwischen den Links absorbiert einen Großteil unserer geistigen Ressourcen. So erhalten die um Aufmerksamkeit konkurrierenden Informationen in unserem Arbeitsgedächtnis nie genug Zuwendung, dass Synapsen im Langzeitgedächtnis angelegt werden können. Die Folge ist der Verlust unseres Gedächtnisses und damit, weil diese auf jenem basiert, auch unserer Intelligenz.
Nennen Sie ein Schlagwort aus dem Buch: Power Browsing.
Haben Sie einen Lieblingssatz? „Wenn wir das Netz durchforsten, sehen wir den Wald nicht. Wir sehen nicht einmal die Bäume. Wir sehen Zweige und Blätter.“ Gemeint ist die zielgenaue Informationssuche, durch die Wissensvermittlung auf momentan relevante Textausschnitte reduziert wird, ohne Blick fürs Ganze. Es ist der Wechsel vom Ideal humanistischer Bildung zum Modus des Kreuzworträtselwissens.
Gibt es Probleme mit dem Buch? Dass es Carrs kurzen Essay von 2008 «Is Google Making Us Stupid? What the Internet is doing to our brains», der schon alle Thesen und Argumente enthält, aufbauscht durch lange Exkurse in die Neurowissenschaft und Geschichte des Lesens.
Warum sollte ich das Buch (oder zumindest den Essay) lesen? Es zeigt die Aktualität von Walter Benjamins Essay «Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit» aus dem Jahr 1936. Während damals mancher Zeitgenosse klagte, das Bombardement mit Bildern im Kino lasse dem Denken keine Zeit hinterherzukommen, sah Benjamin darin ein Übungsinstrument für die „gesteigerte Geistesgegenwart“, die man in der modernen Grossstadt brauchte. Findet ein solches Training der Geistesgegenwart auf Kosten der Geistesarbeit heute im Rahmen der neuen Medien statt? Übernehmen diese damit die Stafette des Kinos – aus den Händen des Fernsehens? Mit welchem Ziel? Carr akzentuiert einen oft ignorierten Aspekt in Benjamins Essay und Benjamin hilft einzusehen, dass Carrs Befund vom Verlust des konzentrierten Denkens noch nicht dadurch falsch wird, dass andere Neurowissenschaftler (Gary Smalls Buch iBrain von 2009) den Multitasking-Praktikern erhöhte Gehirntätigkeit in Bereichen des Arbeitsgedächtnisses und der Entscheidungsfindung attestieren.
Woran erinnert Sie das Buch? An eine Bar in Idaho Falls im Jahr 1992. Es gab mit dem Bartender, mir und meiner Begleiterin fünf Leute im Raum und drei Informationsquellen: eine Musikanlage und zwei Fernseher über dem Tresen. Heute findet man oft drei Fernseher über dem Tresen und einen weiteren in jeder Ecke des Raumes; alle mit einem anderen Sender. Die Sucht nach Reizüberflutung ist offenbar ein kulturelles Verlangen, das vom Internet nicht produziert wurde, aber bedient wird.
„If you’ll walk around with a Bluetooth headset hanging from your ear, you’ll probably walk around with a Google chip in your brain.“