Behinderung, Kultur und Norm. In einer museumsübergreifenden Sammelaktion wurden Objekte zusammengetragen, die das Verhältnis dieser drei Begriffe zueinander hinterfragen.




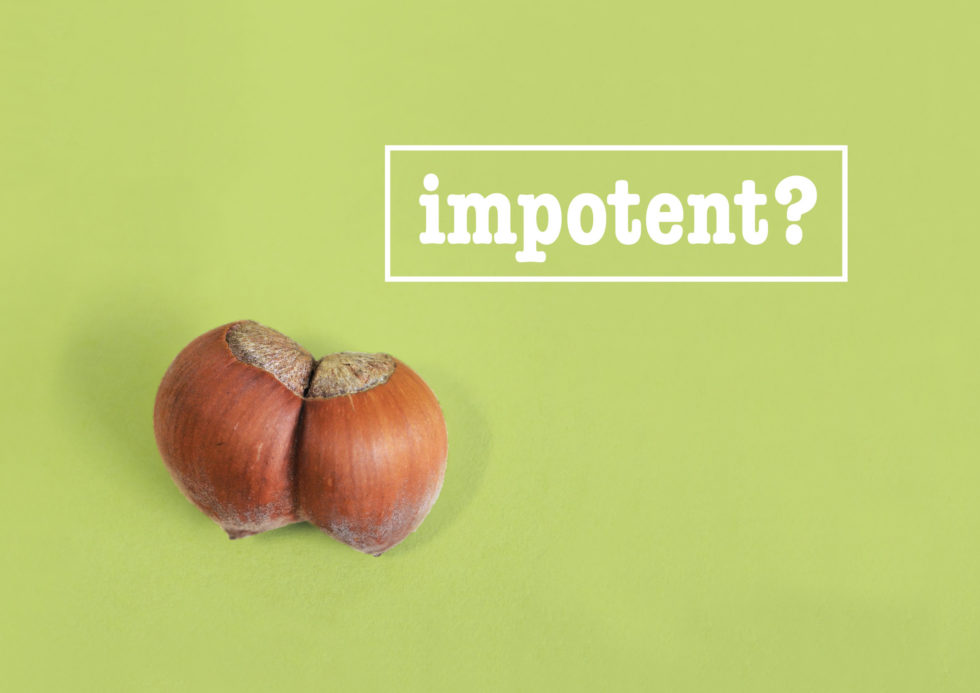

Die Diskussion rund um Grenzen zwischen «Normalem» und «Abnormalem» kommt zu kurz, finden Sandra Hughes von der Abteilung Kultur Basel-Stadt und Martin Haug von der Fachstelle «Gleichstellung von Menschen mit einer Behinderung». Seit einigen Jahren arbeiten die beiden mit Museen im Kanton Basel Stadt zusammen, und versuchen, auf das Thema Behinderung aufmerksam zu machen.
Für ihr jüngstes Projekt wurden 88 Gegenstände und ihre Geschichten gesammelt. Ihre Ansprechspersonen in den einzelnen Museen, die Fachleute für Bildung und Vermittlung, durchstreiften die Sammlungen und Depots nach passenden Gegenständen.
Medizin aus einer schimmligen Probe
Unförmige Glasfläschchen aus dem Pharmaziemuseum, Scherenschnitte von Henri Matisse, Gemälde aus den Museumsdepots, die angefangen, und nicht fertiggestellt wurden – die inhaltliche und formale Vielfalt der Objekte ist gross.
Die Gegenstände werden nicht ausgestellt. Stattdessen wurden die 88 Objektgeschichten auf Tischsets und Faltflyer gedruckt, die nun in Restaurants und an anderen öffentlichen Orten verteilt werden, zudem gibt es eine Facebook Seite dazu, die zur Diskusson anregen will. Dabei werden Objekte in den Fokus gerückt, die unsere Idealvorstellungen und Normen auf irgendeine Art und Weise hinterfragen.
Verstaubte Objekte, die während Jahren im Depot lagen, kommen nun doch noch zu einem prominenten Auftritt. Es sind aber auch sehr bekannte Stücke dabei. Etwa von Henri Rousseau, dessen flächige, wilde Malereien zu seiner Zeit als «primitiv» und «technisch mangelhaft» gesehen wurden, und der heute als Vorreiter der Modernen Malerei gilt.
Über Behinderung sprechen, ohne zu «jammern»
«Etwas Abnormales, oder etwas, das ursprünglich als fehlerhaft galt, nahm im nachhinein häufig eine Vorreiterfunktion ein», sagt Hughes. Dies gelte nicht nur für die Kunst, sondern auch für die Wissenschaft: So wurde der Wirkstoff Penizillin durch eine von Schimmelpilz befallene Probe erfunden, die beinahe im Mülleimer landete.
Hughes findet das Projekt eine gute Art, das Thema Behinderung anzugehen, ohne zu «jammern» und allzu moralisch zu wirken. «Das Schöne am Projekt ist: Wir denken sehr viel über das Thema nach, ohne das Wort Behinderung überhaupt zu erwähnen», sagt Haug.
«Behinderte Menschen sind Künstler – sie müssen eine wahnsinnige Kreativität an den Tag legen.»
Museen seien von Normen dominierte Institutionen – man dürfe meist nichts anfassen, auch nicht zu laut sein. Bei der Auswahl von Ausstellungsobjekten arbeiteten Museen häufig nach Kriterien der Ideale oder der Ästhetik. Hier sieht Haug eine Analogie zur Gesellschaft: Objekte, die einer gewissen Norm nicht entsprechen, werden meist ins Depot «verbannt», ebenso wie Menschen mit einer körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung von der Gesellschaft ausgeschlossen werden.
«Wir wollen die Museen darauf aufmerksam machen, dass die Grenze zwischen normal und abnormal, brauchbar und unbrauchbar, perfekt und imperfekt fliessend ist», sagen Hughes und Haug – und dass das Ausloten dieser Grenzen von grossem Interesse sei, auch für das kulturelle Schaffen.
Haug sieht eine Schnittstelle von Behinderung und Kunst. «Behinderte Menschen sind für mich Künstlerinnen und Künstler. Täglich müssen sie eine wahnsinnige Kreativität an den Tag legen, um all die Hindernisse zu bewältigen, denen sie begegnen.»
