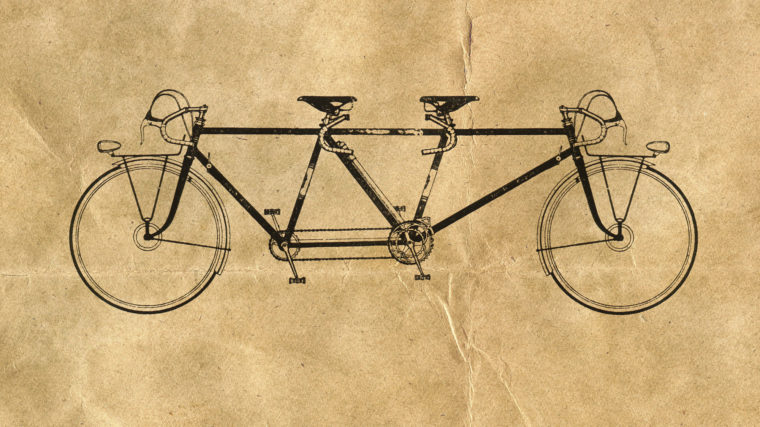Die Basler SP-Regierungsräte stellen sich gegen die 1:12-Initiative – und damit gegen die eigene Partei. Der Konflikt ist eine Folge der einseitigen und gefährlichen Basler Wirtschaftspolitik.
Für alle statt für wenige will die SP stehen. In Basel haben sie ihre eigene Exegese des obersten Parteigebots betrieben. Vor der Abstimmung zur 1:12-Initiative wird bei den Basler Sozialdemokraten jeder fündig. Weltverbesserer halten sich an die Partei, Marktgläubige an Finanzdirektorin Eva Herzog und Konsorten. Die Partei ruft: Mit 1:12 stoppen wir Lohnexzesse, bringen wir die Gesellschaft ins Gleichgewicht. Der Regierungsrat erwidert: untauglich und gefährlich. Und an was soll sich das sozialdemokratische Fussvolk halten?
In den kommenden Wochen werden prominente Basler Sozialdemokraten und Anhänger aus anderen Lagern mit ihren Gesichtern hinstehen und für 1:12 werben. Die SP-Regierungsräte werden nicht dabei sein. Einstimmig lehnen sie 1:12 ab, genauso wie sie einstimmig die «Abzocker»-Initiative verworfen haben, wie sie einstimmig eine Senkung der Unternehmenssteuern wollten – gegen welche die eigene Partei erfolgreich gekämpft hat.
Spricht man mit Parteivertretern über die Kluft in der Wirtschaftspolitik, werben alle um Verständnis: Die eigenen Regierungsräte hätten nun mal durch ihr Amt einen anderen Blickwinkel. «Sie sind Teil eines Gremiums und können deshalb ihre Vorstellungen nicht immer umsetzen, wie sie das eigentlich machen wollten», glaubt die neue Parteichefin Brigitte Hollinger. Das klingt plausibel, aber stimmt es auch?
Drei Brutschins gegen 1:12
Fragt man Volkswirtschaftsdirektor Christoph Brutschin, ob seine Meinung amtsbedingt ist, sagt der: «Sowohl der private Brutschin, wie auch der SP-Politiker Brutschin und der Regierungsrat Brutschin lehnen die Initiative ab.»
Sämtliche Brutschins sind also einer Meinung. Sie sagen: «Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass bestimmte Entwicklungen am oberen Ende der Einkommens-Skala nicht mehr verstanden werden. Ich verstehe sie übrigens auch nicht. Eine Korrektur erfolgt aber viel effektiver über eine Erhöhung der Grenzsteuersätze.»
Da hat er recht. Und auch wieder nicht. Brutschin müsste wissen, dass der unantastbare Steuer-Föderalismus diese Korrektur verunmöglicht. Da kann Basel-Stadt noch so progressive Steuern haben; wenn es rundherum günstiger ist, verpufft der Umverteilungseffekt. Von den 14 Verwaltungsräten der Novartis wohnt keiner im Kanton, ebenso wenig die vier Mitglieder der Geschäftsleitung. Und wenn wir von Lohnexzessen reden, geht es um Novartis, und es geht auch um Roche, die beiden übermächtigen und überlebenswichtigen Unternehmen im Kanton.
Diese scheinen der Regierung deren Nein in den Block diktiert zu haben, ebenso die Begründung dafür. In den regelmässigen Hinterzimmergesprächen mit der Politik brachten sie ihre grosse Sorge über die Initiative zum Ausdruck, heisst es im Regierungsrat. Dessen Argumente gegen die Initiative sind direkter Ausdruck davon. Bei einer Annahme müssten ein Stellenabbau, die schleichende Abwanderung von Grosskonzernen sowie sinkende Steuerträge befürchtet werden.
Bei Geiselnahmen gilt für alle Staaten das eiserne Prinzip: Mit den Geiselnehmern wird nicht verhandelt. Wenn Firmen und Wirtschaftsvertreter mit Abwanderung oder Stellenabbau drohen, sobald das Volk und die Politik eine Änderung der Spielregeln wünschen, dann ist das eine Form von Erpressung. Und die sozialdemokratischen Regierungsräte Brutschin und Herzog kennen darauf keine andere Antwort, als ihr Folge zu leisten und ihre Wirtschaftspolitik danach zu richten.
Wie stabil ist die Nabelschnur?
Natürlich ist es sozialdemokratisch, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen schützen zu wollen. Doch es ist auch ein gefährlicher, vielleicht verhängnisvoller Weg, auf die Bruchfestigkeit der Nabelschnur zu Weltkonzernen zu setzen.
Wie der Druck der Marke Novartis funktioniert, konnte die Region schon einmal erleben. Als Bundesrat Berset 2011 die Medikamentenpreise an den aktuellen Eurokurs anpassen wollte, kündigte der Konzern schweizweit Entlassungen an. Ein Telefonat von Brutschin reichte damals aus, um diese in Basel abzuwenden. Alle waren erleichtert, auch die Entscheidungsträger auf dem Campus: Die Machtdemonstration war geglückt.
1:12 könnte das Verhältnis zwischen Politik und Konzernen entkrampfen.
Den neuen Novartis-Boss Joe Jimenez verbindet so viel mit Basel wie Christoph Brutschin mit Walnut Creek, Kalifornien. Sobald es sich nicht mehr rechnet, verschwindet Novartis Stück für Stück. Tradition und Identität sind keine Bilanzposten. Jimenez muss sich kein Denkmal in Basel setzen wie Daniel Vasella mit dem Campus, er muss sich schon eher von Vasella emanzipieren. Das tut er nicht mit weiteren Investitionen in Basel. Diese Dynamik kann auch die Regierung nicht umdrehen, sie kann sie höchstens verlangsamen.
Das tut sie auf geradezu offensive Weise. Sie baut die Universität für 328 Millionen Steuerfranken zur Ausbildungsstätte für die Industrie um und verwandelt die letzte grosse Landreserve im Hafen zur idealen Wohnumgebung für den Expat-Wanderzirkus; auch die Spitäler werden eingespannt, sie sollen vermehrt Ärzte für die klinische Forschung abstellen.
Getrieben von Verlustängsten begibt sich Basel noch tiefer in die Abhängigkeit von der Pharma. Im Fachjargon nennt man die Identifikation mit dem Geiselnehmer Stockholm-Syndrom.
Das Beste für Basel
Die Wirtschaftspolitik der SP-Vertreter in der Regierung ist nicht amtsbedingt, sie ist durchs Amt beschädigt. Weil sie nach zahllosen Gesprächen in den Konzernzentralen und Blicken in die Steuerstatistik die Wünsche zweier Firmen, oder vielmehr deren Topmanager, über die Wünsche der eigenen Basis und eines beträchtlichen Teils der Gesellschaft stellen. Das tun sie selbstredend in der Überzeugung, damit das Beste für Basel zu bewirken.
Ausgerechnet 1:12 könnte eine entkrampfende Wirkung auf das Verhältnis der Politik zu den Konzernen haben. Der Volksentscheid würde das Spiel aus Drohungen und stetem, stillem Druck auf einen Schlag beenden. Wenn die Regierung das nächste Mal mit den Managern zusammensitzt, würde das Volk mit am Tisch Platz nehmen. Daraus könnte eine selbstbewusste, handlungsfreiere Industriepolitik resultieren, eine, welche die gefährliche Wirtschaftsmonokultur als Problem wahrnimmt – und endlich etwas dagegen unternimmt.
Wahrscheinlicher ist, dass am Abstimmungssonntag ein paar Prozente fehlen. Auch, weil die populären SPler Herzog und Brutschin dagegen waren – für wenige statt für alle.
Artikelgeschichte
Erschienen in der Wochenausgabe der TagesWoche vom 25.10.13