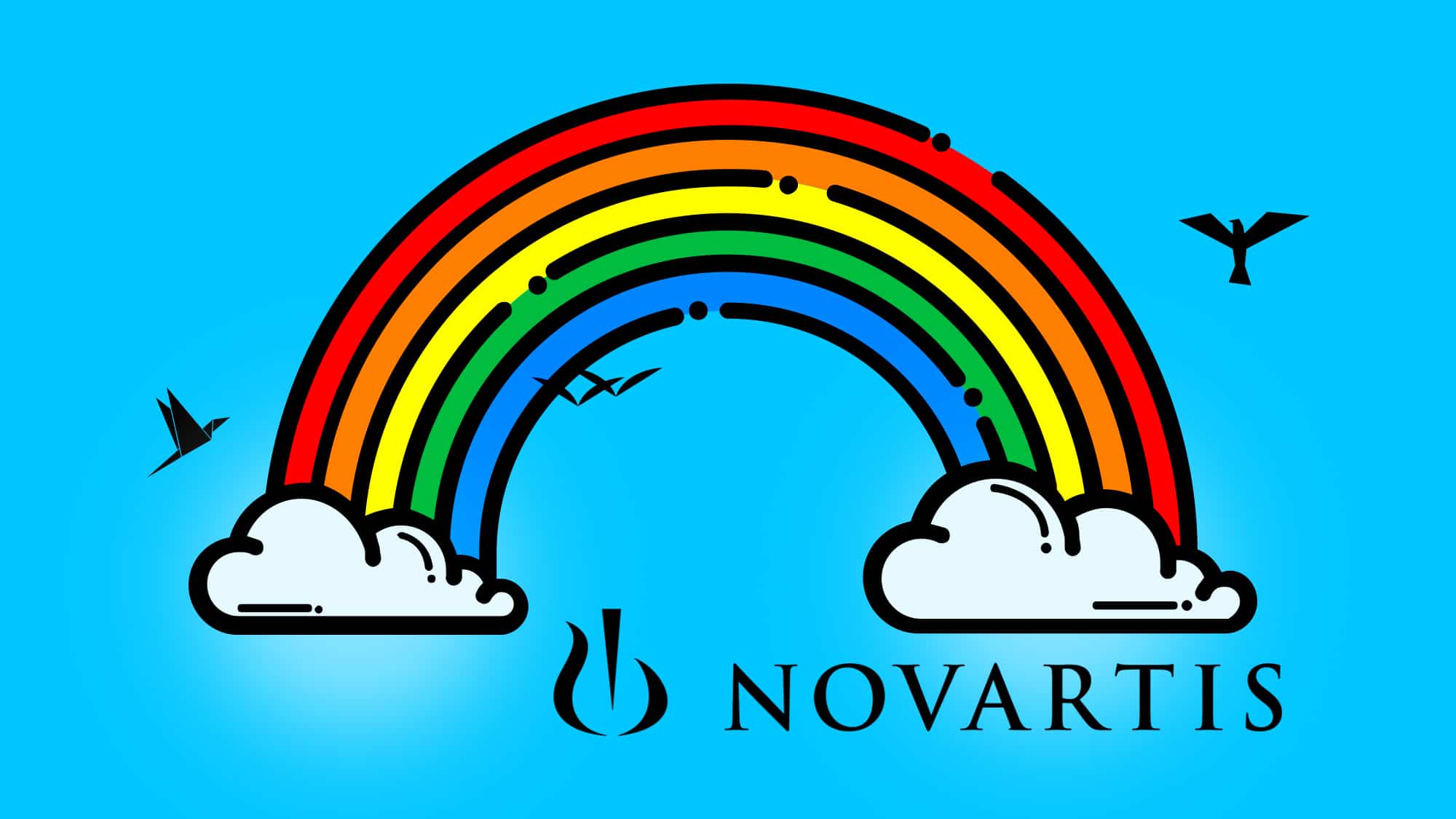
Novartis will der Gesellschaft mehr zurückgeben, als sie von ihr erhält. So liess sich CEO Vas Narasimhan kürzlich in einer Medienmitteilung zitieren. Die Firma hat deshalb neu ihre Ethik-Chefin, Shannon Klinger, in die Geschäftsleitung berufen. Das entspreche der Verpflichtung zu «höchsten ethischen Standards».
Die TagesWoche hätte gerne mit Shannon Klinger über die ethischen Standards des Pharmakonzerns geredet. Doch die Pressestelle schrieb uns zweimal: «keine Zeit». Wie schade. Wir hätten einige Fragen gehabt. Eine Auswahl:
– Was unternimmt Novartis gegen Korruption? In Griechenland laufen Ermittlungen wegen mutmasslicher Schmiergeldzahlungen. Dem Konzern wird vorgeworfen, Ärzte und Verwaltungsangestellte bestochen zu haben, um seine Produkte zu lancieren. In den USA gab es ein Rechtsverfahren der Regierung gegen Novartis wegen Bestechung mittels versteckter Provisionen («Kick-back») von Apotheken. Es kam zu einem Vergleich, Novartis zahlte umgerechnet rund 390 Millionen Franken. Das Rechtsverfahren lief unter dem sogenannten «False Claims Act», dem amerikanischen Nummer-eins-Bundesgesetz gegen Betrug gegen den Staat. Gut zu wissen: Ethik-Chefin und Juristin Shannon Klinger ist gemäss ihrem Lebenslauf Expertin auf dem Gebiet des «False Claims Act».
– Sind Medikamentenversuche in armen Ländern ethisch vertretbar? Novartis wird, wie auch andere grosse Pharmakonzerne, immer wieder beschuldigt, Medikamententests in Ländern wie Indien,Polen oder Ägypten durchgeführt zu haben, um Geld zu sparen. Das sei unethisch, weil ärmere Leute in diesen Ländern aus Geldnot eher bereit seien, das Risiko eines Tests einzugehen. Ausserdem würden sie teilweise nicht über Nebenwirkungen aufgeklärt. Gemäss Novartis werden in klinischen Studien die ethischen Werte befolgt, die in der Erklärung von Helsinki und in der «Good Clinical Practice» verankert sind.
– Ist die Patentpolitik der Novartis ethisch vertretbar? Novartis kämpft in verschiedenen Ländern für verschärfte Rechte für geistiges Eigentum, um ihre Patente zu schützen, beispielsweise im verlorenen Rechtsstreit um das Krebsmedikament Glivec in Indien oder in Kolumbien. Sie argumentiert, sie würde so schlechte Fälschungen verhindern. Dahinter steckt auch die Angst, mit tieferen Preisen Konkurrenzfähigkeit einzubüssen. Die Nichtregierungsorganisation «Public Eye» (früher «Erklärung von Bern») kritisiert dagegen, dass Pharmafirmen so die Herstellung von Generika verhinderten, gerade in Entwicklungs- oder Schwellenländern, wo sich Menschen die teuren Originale nicht leisten könnten.
Gutes tun und darüber reden
In deutlichem Gegensatz zu dieser Kritik steht die Selbstdarstellung von Novartis auf Facebook. Dort herrscht das Motto: Gutes tun und darüber reden, sehr viel darüber reden. So finden sich auf der Seite der Firma zahlreiche Geschichten von dankbaren Afrikanerinnen.
Da ist etwa Suzan aus Uganda. «Ehefrau. Mutter. Ernährerin der Familie». Sie bekam Brustkrebs und wurde von ihrer Gemeinschaft bereits abgeschrieben. In Uganda gilt: Krebs ist unheilbar – weil die Medikamente zu teuer sind. Doch Suzan hat Hoffnung, und das wegen des Novartis-Programms «Access»: Seit 2015 verkauft Novartis chronisch Kranken in armen Ländern patentierte Medikamente für wenig Geld.
Keine Frage, für Suzan ist das Programm eine gute Sache. Doch bringt es unterm Strich etwas, wenn Novartis in ausgewählten Projekten ausgewählten Menschen Medikamente günstig abgibt, sich aber dagegen sträubt, dass die Therapie flächendeckend erschwinglich wird?
Oder anders gefragt: Wer erbringt freiwilliges ethisches Engagement vor dem Hintergrund fehlender, international anerkannter Regeln und Kontrollorgane, die sicher stellen, dass mächtige globale Firmen Menschenrechte und Umweltstandards einhalten?
Eigenverantwortung oder schärfere Gesetze?
Es ist eine alte Frage, sie trennt links und rechts, Aktivisten und Wirtschaft – die einen pochen auf zwingende Gesetze, die anderen auf Eigenverantwortung. Ausdruck davon ist die aktuelle Diskussion um die Konzernverantwortungs-Initiative, die im Oktober 2016 eingereicht wurde. Organisationen wie Alliance Sud, Amnesty International oder WWF fordern eine Sorgfaltspflicht für Schweizer Konzerne. Ziel ist, dass Firmen Menschenrechte und Umwelt im Ausland respektieren müssen – tun sie es nicht, haften sie – und zwar auch für Tochterfirmen.
Heute ist das nicht so: Mutterkonzerne haften nicht für ihre Subunternehmen. Das hat tatsächlich problematische Auswirkungen, wie der ehemalige UN-Sonderbeauftragte John Ruggie in einer Untersuchung festhält. Ruggie hat UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte herausgearbeitet, an denen sich auch die Schweiz orientiert. Er kommt zum Schluss: «Multinationale Konzerne existieren nicht als juristische Grösse.»
Das bedeutet, dass Behörden kaum Einblick haben in die Geschäftspraktiken der Konzerne und beschränkte Möglichkeiten, diese für Fehler zu belangen. Die Initiative will nun der Schweiz juristische Möglichkeiten in die Hand geben.
Leise Drohungen
In der Wirtschaft kommt das nicht gut an. In der Novartis liess sich André Wyss, ehmaliger Chef von Novartis Schweiz, deswegen wieder einmal zu altbekannten drohenden Tönen verleiten: Der Konzern habe in der Schweiz ein sehr gutes Umfeld, doch: «Das Umfeld verschlechtert sich zunehmend», sagte er gegenüber der «Aargauer Zeitung». Die Schweiz müsse vorsichtig sein, um den Standort nicht zu schwächen.
Das sieht auch der Bundesrat so, er hat 2016 einen Aktionsplan für die Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet, schliesst rechtliche Massnahmen aber aus.
Ganz ohne nachhaltiges Engagement geht es trotzdem nicht. Oder zumindest ohne nachhaltiges Image. Auf dem Finanzmarkt gilt: Ein guter Ruf macht sich bezahlt. Das sah man erst gerade am Beispiel des Pharmakonzerns Roche. Am 28. März wurde bekannt, dass Patientenportale einen Zusammenhang zwischen fünf Todesfällen und einem Medikament der Roche-Tochter Genentech herstellten. Der Verdacht hat sich nicht erhärtet, gemäss Ärzten gibt es keinen Zusammenhang zwischen den Todesfällen und den Medikamenten. Trotzdem erlitt Roche an der Schweizer Börse nach den Berichten kurzzeitig einen Verlust von 1,7 Prozent, holte im Verlauf des Tages aber wieder auf.
Ein seriöser Finanzanalyst beachtet Nachhaltigkeit
Das Image ist börsenrelevant. Das bestätigen auch Sandro Merino, Chief Investment Officer, und Ennio Perna, Leiter Fachstelle Nachhaltigkeit der Basler Kantonalbank (BKB). So sagt Merino: «Es gibt je länger je mehr Investoren, die wissen wollen, was die Firma macht, bei der sie das Geld anlegen.» Dabei seien Reputation und Menschenrechte entscheidend. Ein seriöser Finanzanalyst lässt laut Merino deshalb heute nebst Liquidität, Risiko und Rendite auch soziale und ökologische Aspekte in seine Beurteilung einer Firma einfliessen. «Vor 20 Jahren wurden solche Überlegungen noch belächelt, aber jetzt gewinnt die Dynamik an Fahrt», sagt er.
In der Pharmabranche geht es gemäss Perna dabei vor allem um die Fragen der Produktqualität und -sicherheit (gibt es etwa viele Rückrufe aufgrund unerwünschter Nebenwirkungen?), um Arbeitsbedingungen und Personalmanagement, den Umgang mit toxischen Abfällen sowie Haftungsprozesse oder Korruption (werden Ärzte bestochen?). Denn letztlich können ökologische und soziale Verfehlungen auch negative finanzielle Auswirkungen haben, etwa, wenn eine Firma wegen Menschenrechtsverletzungen zu Schadenersatz verpflichtet wird.
Und es gibt auch vermehrt Investoren, die explizit auf nachhaltige Firmen setzen wollen. Für diese bieten viele Banken, so auch die BKB, systematisch nachhaltige Investitionspakete an: Die BKB stützt sich dabei auf Recherchen einer dafür spezialisierten Ratingagentur, der New Yorker MSCI ESG. Diese nimmt sich jede Branche einzeln vor und vergleicht die verschiedenen Firmen. Soziale Projekte und Stiftungen wie das Novartis-Access-Programm, die eine Firma nebst dem normalen Geschäft betreibt, spielen dabei kaum eine Rolle.
Novartis: Abfälle top, Korruption naja
Vielmehr stützten sich die Analysten auf die Nachhaltigkeitsreports der Firmen selbst. Die meisten grossen Firmen, auch Novartis, veröffentlichen nicht mehr nur Jahresberichte, welche die finanziellen Geschäfte offenlegen, sondern freiwillig auch «corporate responsibility reports», die Auskunft geben über die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden, den Verbrauch natürlicher Ressourcen und so weiter.
Diese Berichte sind für die Nachhaltigkeitsanalysen der Finanzinstitute wichtig. Ausserdem ermitteln sie auf der Grundlage von Rechtsfällen und journalistischen Berichten, wie oft eine Firma etwa wegen Korruption belangt wurde. «Diejenigen Unternehmen, die innerhalb einer Branche sozial und ökologisch am besten abschneiden, gelangen dann ins nachhaltige Anlageprodukt», sagt Perna.
Auf der Pharma-Rangliste der MSCI ESG finde sich Roche im oberen Viertel, Novartis etwa im Mittelfeld. Dabei würden aktuelle Entwicklungen miteinbezogen, bestätigt Perna. So fliesse etwa die Kontroverse wegen Korruptionsverdachts gegen Novartis in Griechenland bereits negativ ins Rating ein. «Der Wert in der Kategorie Korruption ist vergleichsweise tief», sagt er. Käme es zu einer Verurteilung, würde das Gesamtrating noch stärker negativ beeinflusst. Ob das gesamte Rating dann so schlecht würde, dass nicht mehr investiert werden darf, kann Perna nicht abschätzen. In den Bereichen toxische Abfälle und Personalmanagement beispielsweise schneide Novartis gut bis sehr gut ab.
Was heisst schon «nachhaltig»?
Zusätzlich wendet die BKB auch Ausschlusskriterien an, wie in den Richtlinien zu kontroversen Umwelt- und Sozialthemen nachzulesen ist. Unternehmen etwa, die über 20 Prozent ihres Umsatzes mit Kohle erzielen, sind bei der BKB grundsätzlich ausgeschlossen, auch in konventionellen Anlagen. Bei nachhaltigen Geldanlagen sind die Ausschlusskriterien strenger. Firmen zum Beispiel, die mehr als 10 Prozent ihres Umsatzes in der Rüstungs- oder Atomindustrie erzielen, sind tabu. Gemäss Perna hat die BKB aber noch nie eine Basler Pharmafirma ausgeschlossen.
Die ganze Diskussion zeigt: Nachhaltigkeit ist im Trend. Das könnte im besten Fall durchaus zu einem Nachhaltigkeits-Wettbewerb zwischen den Firmen führen.
Doch was heisst «nachhaltig»?
Das steht nirgends geschrieben und hängt vom Finanzinstitut und der Geschäftsphilosophie ab. Und vom Know-how der Analysten. Das wiederum erhöht die Gefahr, dass nicht alles so nachhaltig ist, wie es glänzt. Merino hält insbesondere fest: «Wenn eine Firma einen Fehler im Geschäftsbericht hat, gibt es einen riesen Tanz. Das ist strafrechtlich relevant. Aber ob die Angaben in den Nachhaltigkeitsberichten der Firmen stimmen, ist nicht reguliert.» Und das Schweizer Wirtschaftsmagazin «Bilanz» schrieb Ende März: «Zunehmend wird das Thema Nachhaltigkeit auch zu Marketingzwecken eingesetzt.» Auch von Finanzinstituten.
1,2 Milliarden Dollar teure Umweltverschmutzung
Novartis jedenfalls will gemäss dem eigenen «Corporate Responsibility Report» ihr Engagement 2018 noch ausweiten. Etwa was Medikamente in armen Ländern betrifft. «We plan to systematically integrate patient
access strategies into all our new medicine launches», heisst es. Es soll also bei allen künftigen Medikamenten spezielle Programme für mittellose Patienten geben.
Ausserdem habe die Firma die Anti-Korruptions-Bemühungen ausgebaut und eine Methode entwickelt, welche die finanziellen, ökologischen und sozialen Auswirkungen untersuche, welche die Geschäftspraktiken von Novartis auf die Gesellschaft haben. So hat die Firma 2016 beispielsweise 260’000 zusätzliche Jobs geschaffen und mit einer Wertschöpfung von 65 Milliarden zur Weltwirtschaft beigetragen. Den durch Umweltverschmutzung verursachten Schaden beziffert sie für 2016 auf 1,2 Milliarden Dollar. Das Ziel ist, ihn weiter zu reduzieren.
Was heisst das genau? Die TagesWoche hätte mit Shannon Klinger gerne darüber geredet.