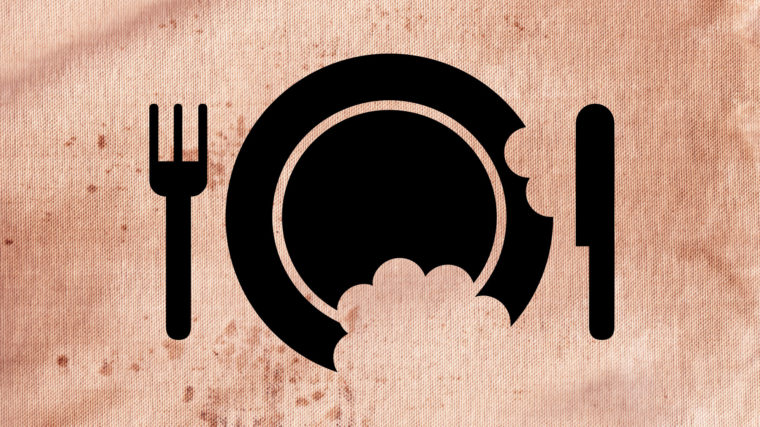Eine neue Studie zeigt auf, wo es noch Handlungsbedarf gibt, damit Familien nicht in die Armut abrutschen. Dabei steht Basel nicht nur gut da: Bei Betreuungsplätzen und der Nachholbildung hapert es etwa. Fachleute diskutierten daher an einer Podiumsdiskussion über mögliche Ansätze.
Wenn es um die Bekämpfung von Familienarmut geht, kann Basel einerseits punkten, hat aber auch noch reichlich Aufholbedarf. Das geht aus der kürzlich erschienenen Studie «Prävention und Bekämpfung von Familienarmut in Städten und Gemeinden» hervor.
Diese wurde vom Büro für sozial- und arbeitspolitische Studien (BASS) im Auftrag des Nationalen Programms zur Prävention und Bekämpfung von Armut erstellt. Dabei wurden mehrere Schweizer Städte und Gemeinden, darunter auch Basel, unter die Lupe genommen.
Heidi Stutz, Bereichsleiterin Familienpolitik beim Büro BASS, präsentierte am Donnerstagabend einige Erkenntnisse aus dieser Studie. An einer Podiumsdiskussion, die vom Erziehungsdepartement und dem Zentrum für Familienwissenschaften der Uni Basel organisiert wurde, brachte sie mehrere Punkte zur Sprache.
«Finanzielle Hilfe lindert Probleme nicht nachhaltig», sagte Stutz. Strategien müssten daher umfassender ansetzen. «Familienarmut ist kein marginales Problem», betonte sie. Besonders betroffen seien Einelternhaushalte und Familien mit Migrationshintergrund. «Es braucht nicht nur Einzelprojekte, sondern Grundstrukturen, um Armutsfallen zu vermeiden.»
Basel kann bei den Betreuungsplätzen noch zulegen
Wie aus der Studie hervorging, steht Basel bei der Familienarmut in einigen Bereichen gut da. Gute Voraussetzungen sind gemäss Stutz die hohe Wirtschaftsleistung des Kantons, finanzstarke Stiftungen sowie eine gute rechtliche Verankerung. Dennoch herrsche in Basel im Vergleich zu anderen Städten noch Nachholbedarf – so etwa bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Zahlbare Betreuungsplätze seien noch immer Mangelware.
Die Erwerbsintegration von Müttern – insbesondere solcher mit tiefer Qualifikation – sei hier ebenfalls noch relativ tief. Zudem könne Basel bei der Schulsozialarbeit noch einen Zacken zulegen. In anderen Kantonen sei dies mittlerweile Standard. Die Chancengerechtigkeit für die Kinder müsse generell konsequenter gefördert werden.
Kanton Waadt als Vorbild
Auch hätten Leute mit Familien es schwer, wenn sie eine Ausbildung nachholen wollen. Dabei nannte Heidi Stutz den Kanton Waadt als Vorbild für die anderen Kantone: Die Sozialhilfe werde dort mit dem Stipendienwesen harmonisiert, sodass Leute mit schlechten Karten auf dem Arbeitsmarkt parallel zu Beruf und Familie leichter eine Weiterbildung absolvieren können.
Dass sich die Politik noch nicht zurücklehnen kann, stellte auch Monika Pfaffinger fest. Die Assistenzprofessorin für Privatrecht legte den Fokus auf immer noch sehr präsente Rollenbilder, die in ihren Augen eng mit dem Thema Familienarmut verbunden sind.
Obschon sich das Bildungsniveau von Mann und Frau angenähert habe, gebe es mit der Geburt der Kinder oder bereits vorher einen Knick hin zu tieferen Erwerbspensen. Pfaffinger sprach daher von einem «langen Schatten der Hausfrauenehe». Im Gegensatz etwa zu den skandinavischen Ländern stecke die Schweiz in Sachen Elternzeit oder Kitas noch in den Kinderschuhen.
Alte Rollenbilder halten sich noch immer in den Strukturen
Trotz vieler Veränderungen schimmere noch immer das Familienideal des verheirateten Paars durch, bei dem die Ehefrau den Haushalt führt. «Die faktische Verwirklichung von Leitideen ist nicht gewährleistet», meinte Monika Pfaffinger. Strukturelle Mechanismen führten immer noch dazu, dass Mütter Care-Arbeit und Väter die Erwerbsarbeit leisteten. Mit diesen Rahmenbedingungen, etwa ohne Vaterzeit, sei es für Männer schwierig, in die Care-Arbeit hereinzukommen.
Georg Mattmüller, Geschäftsführer des Behindertenforum, Präsident des Vereins Alleinerziehender (Eifam) Region Basel und SP-Grossrat, unterstrich ebenfalls die Notwendigkeit einer Elternzeit in der Schweiz. Gleichzeitig ging Mattmüller auf die Mütter ein, die den Wiedereinstieg in den Beruf wagen: Diese Frauen vermehrt unter Druck zu setzen, indem ihre Rückkehr möglichst rasch verlangt werde, sei keine Lösung – es brauche zusätzliche Unterstützung.
Zudem nannte Mattmüller die besonders schwierige Situation vieler Alleinerziehender: Er unterstrich, dass für diese Leute nicht nur der finanzielle Aspekt entscheidend sei. Es gehe schliesslich auch um die psychische Gesundheit angesichts der Doppelbelastung durch Beruf und Kinder.
Privatwirtschaft muss stärker anpacken
Dass die Sensibilisierung für diese Themen auch bei den Arbeitgebern angekommen ist, wurde von den Diskutierenden bezweifelt. Bezeichnend dafür war die Frage des Moderators Roland Fankhauser in die Runde: «Haben wir jemanden aus der Privatwirtschaft hier, der sich für Familienarmut interessiert?» Erwartungsgemäss meldete sich niemand.
Jörg Dittmann, Dozent an der Hochschule für Soziale Arbeit, meinte, dass auch in der Arbeitswelt gewisse Rollenbilder aufgebrochen werden müssten. «Gegen Familienarmut – das soll nicht nur eine Leerformel bleiben», sagte Dittmann.
Georg Mattmüller sah gewisse Parallelen zur Integration von Behinderten in die Privatwirtschaft: Es sei bis jetzt eher eine Frage der Freiwilligkeit und des Goodwills in den Führungsetagen – und die halten sich bis jetzt noch in Grenzen.