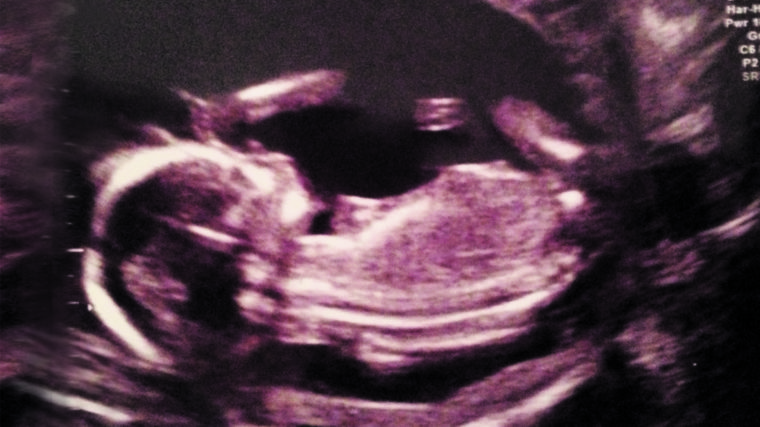Der Druck auf werdende Eltern, vorgeburtliche Untersuchungen vornehmen zu lassen, wird immer grösser. Was aber, wenn die Eltern gar nicht wissen wollen, ob ihr Kind eine Behinderung haben könnte?
Wie hoch ist das Schwangerschaftsrisiko für mich wirklich als über 40-Jährige? Und wie sehr kann ich noch über meinen eigenen Körper bestimmen?
Mit diesen Fragen ist Selina F. während ihrer zweiten Schwangerschaft konfrontiert. Sie hat bereits einen zehnjährigen Sohn, damals hatte es vier Jahre gedauert, bis sie endlich schwanger wurde. Beim zweiten Mal war es noch schwieriger. Erst vor einigen Monaten, als sie die Hoffnung längst aufgegeben hatte, klappte es endlich wieder. Die Freude über die unerwartete Schwangerschaft wurde allerdings schon bald wieder weggespült – von einer gynäkologischen Kontrollflut.
Bei ihrem ersten Termin bei der Frauenärztin hat diese dem Paar zwar kurz gratuliert, Selina F. aber bald darauf klargemacht, dass sie bereits zu den «Risikoschwangeren» gehöre. Sie gab ihr einen Stapel Informationsunterlagen über Risikoschwangerschaften und Pränataldiagnostik mit, die sie doch bitte durchlesen solle.
Risikofreier Bluttest
Um die Pränataldiagnostik kommt heute keine Familie mehr herum, das war Selina F. von vorneherein klar. Bereits bei ihrem ersten Sohn machte sie eine solche Untersuchung. Ihre Frauenärztin meinte damals, die Werte seien «grenzwertig». Da der Ersttrimester-Test aber nicht sehr treffsicher ist, empfahl sie der Patientin eine Fruchtwasserpunktion: Die Sicherheit einer Diagnose ist dabei mit 99 Prozent wesentlich höher, es besteht aber auch ein einprozentiges Risiko einer Fehlgeburt.
Selina F. wehrte sich gegen diesen Vorschlag, denn sie wusste von Anfang an, dass sie das Kind in jedem Fall bekommen wollte: «Es fällt mir schwerer als anderen Frauen, schwanger zu werden. Mein Kind unnötigerweise einem Risiko auszusetzen, war für mich undenkbar.»
Zehn Jahre später. Der Junge, dessen genauere Untersuchung Selina F. damals empfohlen worden war, stellte sich vor Kurzem als hochbegabt heraus. Selina F. ist ein zweites Mal schwanger. Und wieder wirft die Pränataldiagnostik Fragen für sie auf.
Ein neuer Bluttest, mit dem der Embryo auf eine Trisomie untersucht werden kann, ist in der Schweiz seit Mitte August 2012 auf dem Markt. Er macht vorgeburtliche Untersuchungen noch einfacher, denn er ist mit einer Treffsicherheit von 98 bis 99 Prozent um einiges zuverlässiger als der bisherige Ersttrimester-Test. Damit kann er sich mit den invasiven Methoden, etwa der Fruchtwasserpunktion, messen und ist völlig risikofrei.
Wegen des neuen Bluttests gingen die ausgeführten Fruchtwasserpunktionen massiv zurück, und zahlreiche Fehlgeburten wurden verhindert. Doch der neue Test birgt auch eine Gefahr: Durch die absolute Risikofreiheit könnte die Hemmschwelle einer pränatalen Untersuchung herabgesetzt werden. Martin Haug von der Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit einer Behinderung sagt: «Ich halte es für durchaus möglich, dass solche Tests irgendwann zum Standardverfahren gehören.»
Flut an Untersuchungen
Die Details des neuen Bluttests wurden der 41-Jährigen von ihrer Ärztin dargelegt. Ein wichtiges «Detail» schien dabei eine untergeordnete Rolle zu spielen: Die Tatsache nämlich, dass sie auf keinen Fall abtreiben wollte und auch mit einem behinderten Kind glücklich wäre. «Ich war nahe dran, den Test zu machen, bloss um der Frauenärztin einen Gefallen zu tun.»
Die Grundversicherung übernimmt die Kosten für die neue Untersuchung allerdings nicht, diese können bis zu 1000 Franken betragen. Ihre Frauenärztin habe ihre Entscheidung, auf den Test zu verzichten, zwar akzeptiert, könne aber anscheinend «schlecht damit leben» und wirke «extrem gestresst».
Bei ihrer ersten Schwangerschaft musste Selina F. nur drei Untersuchungen machen, nun ist sie in der Hälfte der Schwangerschaft und war bereits fünfmal bei der Kontrolle. Sie musste Dokumente unterzeichnen, in denen sie versicherte, dass sie von der Ärztin über mögliche Risiken aufgeklärt wurde und freiwillig auf den Bluttest verzichtete.
Sibil Tschudin, Leiterin der Abteilung für Sozialmedizin und Psychosomatik der Frauenklinik des Universitätsspitals, erklärt, dass Frauenärztinnen verpflichtet seien, die Patientinnen über die Möglichkeiten der Pränataldiagnostik aufzuklären. Eine gute Dokumentation zur persönlichen Absicherung der Ärzte ist vor allem dann wichtig, wenn Leute keine Untersuchungen wollen und schützt vor möglichen Klagen. Es ist schon vorgekommen, dass Eltern, deren Kind mit einer Behinderung zur Welt kam, sich im Nachhinein bei den Ärzten über mangelnde Aufklärung beschwerten.
Das Recht auf Nichtwissen
«Wir müssen informieren, ohne zu beeinflussen», sagt Tschudin. «Gleichzeitig haben Patientinnen ein Recht auf Nichtwissen. Das ist sehr wichtig.» Im Bundesgesetz über genetische Untersuchungen ist eine Pflicht zur objektiven Beratung der Ärzte vor pränatalen Untersuchungen verankert. Doch sei dies nicht immer einfach. «Sobald Ethik und Weltanschauung mitspielen, bleibt die eigene Meinung selten ganz aussen vor.»
Tschudin sagt auch, dass es Ärzten nicht immer leicht falle zu akzeptieren, wenn jemand keine oder nur einen Teil der Unterstützung in Anspruch nehmen will. Schwangere seien in der Regel dankbar für die vielen Untersuchungsmöglichkeiten und würden ein hohes Mass an Sicherheit verlangen, sagt die Sozialmedizinerin. «Wenn ein Paar sich dann bewusst gegen pränatale Tests entscheidet, sind die behandelnden Fachpersonen gelegentlich in Sorge, dass es sich der möglichen Konsequenzen nicht wirklich bewusst sei.»
Das Schwierige an der pränatalen Diagnostik sieht Tschudin vor allem darin, dass die damit verbundenen Fragen zu einem überwiegenden Teil hypothetisch sind: «Bei wenigen Föten wird tatsächlich eine Trisomie festgestellt.» Und trotzdem müssen sich alle Paare heute mit der Möglichkeit auseinandersetzen und sind dann «unnötig gestresst». Dadurch hat sich das Erleben der Schwangerschaft verändert: «Die frohe Erwartung wird getrübt, und es kommt schon früh zu einer Verunsicherung.»
Gesellschaftlicher Druck
Peter Miny ist Leiter der medizinischen Genetik am Universitätsspital Basel. Er sieht zwar ein, dass die Möglichkeiten pränataler Diagnostik auch viele Ängste mit sich bringen. Doch diese Tendenz ist für ihn in der ganzen Gesellschaft spürbar: «Die Verunsicherung resultiert aus neuem Wissen und aus diversen Wahlmöglichkeiten, die man früher nicht hatte. Während Paare eine Schwangerschaft früher mehr oder weniger blind durchlebten, wissen sie heute über die verschiedenen Risiken Bescheid. Ich denke, das ist ein fairer Preis für die Selbstbestimmung, die gleichzeitig möglich wird.» Doch wie viel «Selbstbestimmung» ist tatsächlich gewährleistet?
Diese Frage stellt sich auch Selina F. «Weshalb muss ich mir lange Vorträge über Pränataldiagnostik anhören, obwohl ich das Kind auch will, wenn es behindert ist?» Pränatale Untersuchungen gehören zwar nicht zum Standardverfahren, trotzdem können sich werdende Eltern dem gesellschaftlichen Druck schlecht entziehen. Selina F. sagt: «Alles dreht sich um das Thema Behinderung, und dabei gehen andere, wichtigere Fragen vergessen.» Denn die Schwangerschaft bleibt trotz aller Untersuchungen unberechenbar.
Die Pränataldiagnostik konzentriert sich auf einen Bruchteil aller Behinderungen, nämlich auf diejenigen, die während der Schwangerschaft diagnostizierbar sind. Auch die Behindertenorganisation Insieme betont dies in einer Stellungnahme: «Eine Garantie für ein gesundes Kind existiert nicht. Die meisten Beeinträchtigungen sind vorgeburtlich nicht erfassbar und treten erst nach der Geburt auf.»
Zur gesetzlich verankerten Beratungspflicht der Ärzte gehöre es auch, darüber aufzuklären, wie positiv der Lebenslauf einer Person mit Down-Syndrom heute aussehen kann. Laut Martin Haug hat die Gesellschaft diesbezüglich Nachholbedarf: «Der gesellschaftliche Diskurs über Behinderungen ist sehr leidgeprägt. Dies entspricht nicht der Realität. Menschen mit Down-Syndrom können heute ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben führen.»
Wann ist Leben «lebenswert»?
Das Thema der pränatalen Untersuchungen ist eng verknüpft mit der unangenehmen Frage, welches Leben «lebenswert» ist. Scharfe Kritiker der pränatalen Diagnostik, etwa der Liedermacher Linard Bardill, sprechen von einer vorgeburtlichen Exklusion von Menschen mit einer Behinderung.
Doch Haug ist der Meinung, dass der Entscheid, vorgeburtliche Tests zu machen oder darauf zu verzichten, nicht moralisch bewertet werden darf. «Die Tests gibt es, und man kann sie werdenden Eltern nicht vorenthalten. Entscheidend ist aber, dass sie rechtzeitig und umfassend über die Tests und ihre Konsequenzen informiert werden.»
Eltern, die sich für ein behindertes Kind entscheiden würden, dürften jedoch nicht verurteilt werden und keine benachteiligenden Folgen tragen müssen, sagt Haug: «Sie müssen gut informiert eine Entscheidung treffen können, und diese Entscheidung ist zu akzeptieren.»
Natürlich versteht Selina F. die Beunruhigung ihrer Frauenärztin. Und trotzdem hätte sie sich mehr Ruhe, Vertrauen und Gelassenheit gewünscht. «Als Schwangere werde ich behandelt, als sei es eine Krankheit, die man extrem scharf beobachten muss, damit nichts aus dem Ruder läuft. Dabei ist schwanger sein doch total natürlich, das Normalste der Welt.»