Einmal habe ihn der Besuch einer Patientin gefragt, woher er komme. «Aus Eritrea», antwortete Pflegehelfer Zeru Fesseha damals. «Wirklich?», kam zurück. «Sie sind jetzt schon der zweite Eritreer, den ich treffe, der einen Job hat.»
Vorurteile wie diese kommen nicht von ungefähr. Sie sind Resultat einer einseitigen Berichterstattung über die eritreische Diaspora in der Schweiz.
Flüchtlinge aus Afrika sind schwarz – und sie machen Kinder!
Über 30’000 Eritreer leben in der Schweiz. In den Medien wird meistens über sie und äusserst selten mit ihnen gesprochen.
Das Bild, das Schweizer Medien von Eritreern zeichneten, sei falsch, sagt Zeru Fesseha in gutem Deutsch. «Dass wir alle nicht arbeiten wollen und Ferien mit dem Geld der Sozialhilfe machen, stimmt einfach nicht.»
Fesseha kam im Dezember 2008 gemeinsam mit seiner Frau Sarah in die Schweiz. In seiner Heimat lebte er in Angst, in den Militärdienst eingezogen zu werden und danach sein Leben lang im Nationaldienst bleiben zu müssen, unter Bedingungen, die die UNO als Zwangsarbeit und Sklaverei einstuft.

17 Monate wartete das Ehepaar in Basel auf den Asylentscheid, bis er im Mai 2010 in Form einer B-Aufenthaltsbewilligung kam. Der heute 35-Jährige verkaufte bis zu diesem Entscheid bereits «Surprise»-Magazine, lernte Deutsch und erhielt dann mit dem neuen Aufenthaltsstatus nach der fünfzigsten Bewerbung eine Stelle als Praktikant in der Pflege – seine Ausbilung als Pflegekraft in Eritrea wurde in der Schweiz nicht anerkannt. Mittlerweile ist der zweifache Familienvater festangestellt. Die Fessehas sind nicht mehr von der Sozialhilfe abhängig.
Viele seiner Bekannten hätten wie er Nachholbildungen abgeschlossen und würden ganz normal arbeiten, erzählt Fesseha. Andere hätten sogar an der Fachhochschule in Olten studiert. «Natürlich gibt es auch viele arbeitslose und schlecht integrierte Eritreer», sagt er. Und bestimmt gebe es auch vereinzelt solche, die nach Eritrea gehen würden, um ihre älteren Verwandten zu pflegen. Ferien seien das aber nicht.
Die oft angesprochenen Integrationsprobleme kann Zeru Fesseha nicht von der Hand weisen. «Viele Leute sind wie kleine Kinder, wenn sie hier ankommen», sagt er. «Sie haben womöglich Leute verloren auf der Flucht, in der Sahara oder im Mittelmeer.» Es sei alles anders hier, die Kultur, die Sprache und die Mentalität. Die Schweizer seien auch eher zurückhaltend gegenüber Fremden. «Schlussendlich liegt es aber immer an der Person, ob sie sich integriert und nicht an der Herkunft.»
«Das Ziel ist es, das Image der Eritreer in der Schweiz zu verschlechtern.»
Eine solch differenzierte Betrachtung sucht man bei manchen Schweizer Medien vergeblich. BaZ-Chefredaktor Markus Somm liess sich beispielsweise dazu verleiteten, allen Eritreern eine «schwierige, traurige Zukunft» in «unserem Land» zu prophezeien. Mit Aufmachern wie «10-mal mehr Flüchtlings-Babys aus Eritrea» setzte die grösste Gratiszeitung der Schweiz noch einen drauf und machte noch mehr Stimmung gegen die Ostafrikaner.
Die mit falschen Zahlen, Statistiken und einseitigen Politiker-Statements gespickte «20 Minuten»-Berichterstattung macht Okbaab Tesfamariam vom Eritreischen Medienbund Schweiz wütend. «Politiker und Medien gehen gezielt auf uns los», sagt Tesfamariam. «Das Ziel ist es, das Image der Eritreer in der Schweiz zu verschlechtern.»
Dass Medien Eritreer vorwiegend als Profiteure und «Asylschmarotzer» darstellen, habe konkrete Auswirkungen für seine Landsleute im Alltag. «Wir haben fast keine Möglichkeit, einen Job zu bekommen. Auch solche mit einer B-Aufenthaltsbewilligung haben praktisch keinen Zugang zum Arbeitsmarkt.» Das erschwere die Integration extrem.
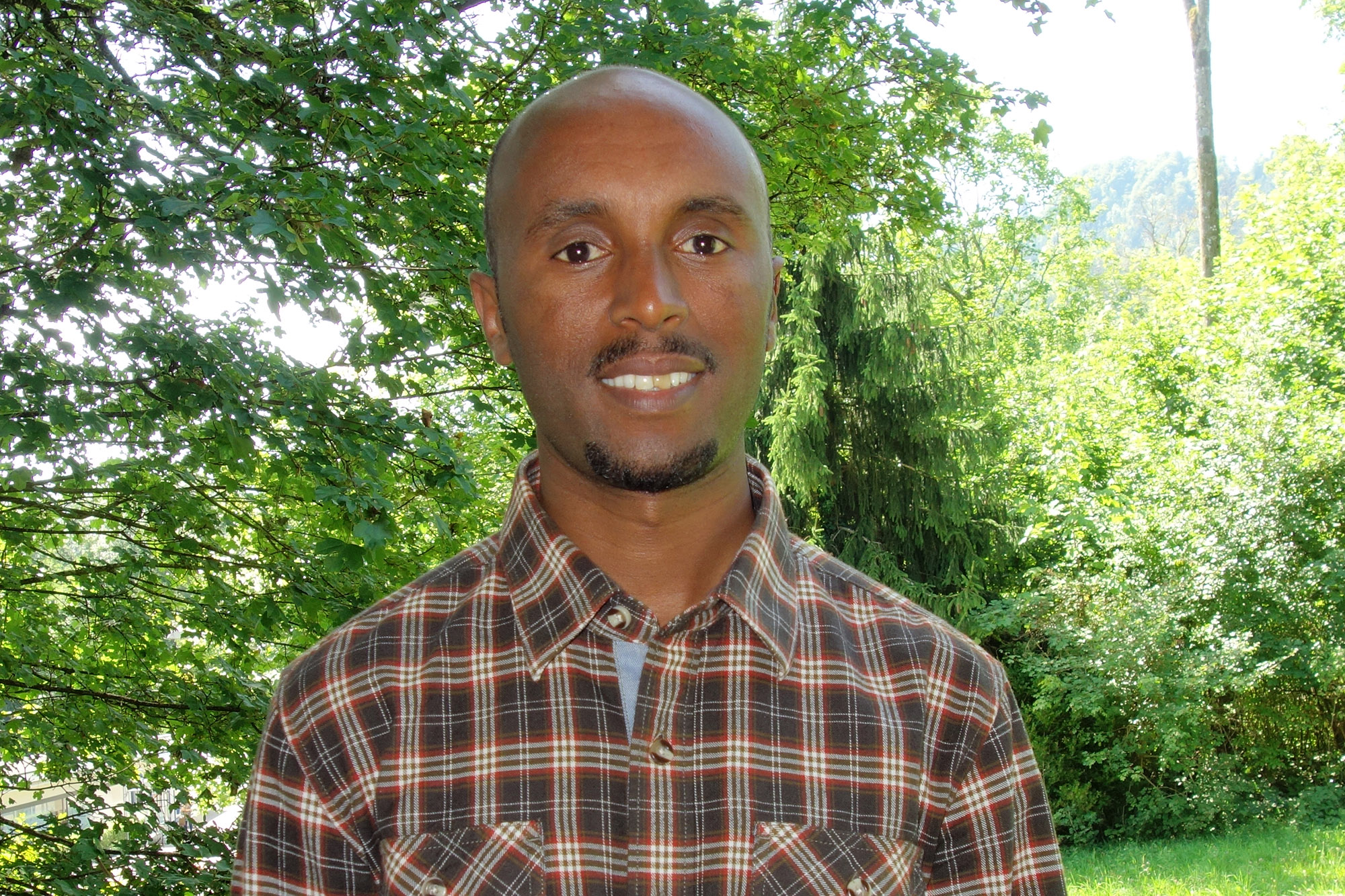
Eine These der jüngsten «20 Minuten»-Artikel weist Tesfamariam empört zurück, nämlich, dass die eritreischen Immigranten angeblich vorsätzlich viele Babys machen, um sich bessere Bedingungen im Asylverfahren oder bei der Sozialhilfe zu schaffen. «Kinder gehören zu unserer Kultur», sagt er. Aber sicher nicht aus berechnenden Motiven. Zumal die Sozialhilfe ja – wenn überhaupt – ohnehin nur eine kurzfristige Lösung sein könne.
Eine Frage der Glaubwürdigkeit
Was ihn ebenfalls empört: dass Politiker der Schweizer Bevölkerung weismachen wollen, dass sich die Situation in Eritrea verbessert habe. Die habe sich überhaupt nicht verändert, sagt Tesfamariam. Er spricht die Reise der Berner SVP-Grossrätin Sabine Geissbühler an, die sich in Eritrea persönlich davon überzeugen wollte, dass Flüchtlinge die Schweiz unnötig viel kosten. Im «Blick» durfte sie ihre von der Regierung beeinflussten Reiseeindrücke dann ganz ungefiltert wiedergeben – ihr Fazit: halb so schlimm.
«Wir sind keine Wirtschaftsflüchtlinge», sagt der 32-Jährige, der sich in Zürich mit einem integrativen Stadtrundgang für den Austausch zwischen Eritreern und Einheimischen einsetzt. In seinem Heimatland könne man sich weder frei bewegen noch frei äussern.
Zeru Fesseha, der wie Tesfamariam 2008 in die Schweiz kam, ist froh, hier zu sein. «Wir sind zu einer guten Zeit gekommen», sagt er. «Die, die jetzt kommen, haben es schlimm. Wir, die ältere Generation, sind indirekt Schuld daran, weil einige von uns ein schlechtes Vorbild waren.»
Einige vielleicht, aber nicht alle.
