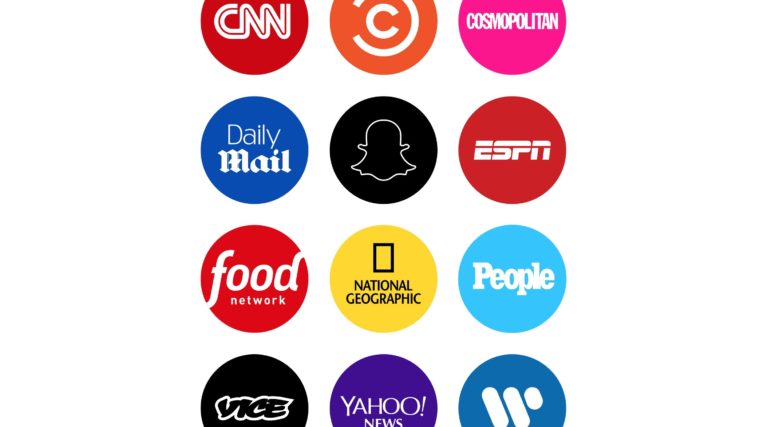Das als Sex-App konzipierte Snapchat macht vor, wie der Journalismus der Zukunft aussehen könnte. Medien von CNN bis «Vice» produzieren Inhalte für die App und kommen so zu einem neuen Millionenpublikum. Bereits buhlen Facebook, Youtube & Co. um die Inhalte der grossen Häuser.
Der junge Video-Journalist Ramon Iriarte sass erst ein paar Wochen in seinem neuen Büro in Miami, als er eine merkwürdige E-Mail seiner Bosse öffnete. Iriarte war von New York hergezogen, wo er für Al Jazeera und MSNBC über Politisches aus Mittel- und Südamerika berichtete. Seinen neuen Job in Miami hatte er «Fusion» zu verdanken, einem neuen Unternehmen der Mediengiganten Disney und Univision mit reichlich Geld und Freiheiten. Für «Fusion» sollte er eine eigene TV-Show produzieren. Oder eben nicht: Der Plan habe sich geändert, liess das Management wissen. Die Sendung werde nicht im Fernsehen gezeigt. Sondern auf Snapchat.
Snapchat, diese Messaging-App des verzogenen, superreichen Kaliforniers Evan Spiegel. «Ich dachte, das sei ein Witz», sagte mir Iriarte bei einem Besuch in den New Yorker Büros von «Fusion». «Ich kannte Snapchat kaum. Ich wusste einfach, dass die Nachrichten da nach zehn Sekunden wieder verschwinden.»
Links sind nicht mehr genug

Ramon Iriarte
Was Iriarte da erlebte, dürfte künftig noch einer Reihe seiner Kollegen blühen. Denn die Entwicklung ist einer der grössten Trends der Medienbranche zurzeit. Den sozialen Netzwerken sind Links nicht mehr genug. Sie wollen nicht nur auf die besten Videos, Artikel und Bilder verweisen, sondern genau diese selbst zeigen. Mit kostenlosen Inhalten wie Babyfotos und verwackelten Homevideos sind sie zu globalen Plattformen geworden. Und zu Werbegiganten. Doch nun wollen sie auch die Werber auf ihre Plattform holen, die ihre Produkte lieber nicht neben verwackelten Videos oder umständlich formulierten Ferienberichten zeigen möchten, sondern neben den Texten, Bildern und Inhalten von professionellen Verlegern und Produzenten.
Um an diese Inhalte zu kommen, bieten sich die Netzwerke den Verlegern als Vertriebsnetzwerke an. Sie sollen ihre Texte, Artikel und Videos nicht mehr über die eigenen Verteilzentren, Apps oder Webseiten an die Leser und Zuschauer bringen, sondern über die Netzwerke, auf denen sich ihre Leser ohnehin schon tummeln: auf Facebook, auf Youtube oder eben auf Snapchat.
Die Zahlen waren es schliesslich, die auch Ramon Iriarte überzeugt haben. «Ein Journalist will einfach, dass ihm keiner reinredet, und dass möglichst viele seine Inhalte sehen.» Ein Kollege ergänzt: «Das Wichtige war halt, dass sie uns sagten, dass wir ein potenzielles Publikum von 70 Millionen haben.» Insgesamt hat Snapchat 100 Millionen Nutzer, der «Fusion»-Kanal ist aber nur ausserhalb der USA zu sehen.

Erstmals sind die Tech-Giganten offenbar bereit, für die besten Inhalte von Verlegern extra zu zahlen. Snapchat gibt einem Bericht von Re/Code zufolge 50 bis 70 Prozent der Werbeeinnahmen an Verleger ab. Snapchat selbst äussert sich hierzu nicht. Einem Bloomberg-Bericht zufolge sollen die Preise doppelt so hoch sein wie bei Youtube. Facebook arbeitet laut «The Information» an einem Premium-Werbeprodukt und kooperiert dabei mit Videoproduzenten von bekannten Medienhäusern wie «Vice» und Vox Media. Google schliesslich hat jüngst in den USA das «Preferred»-Werbeformat eingeführt, wo Werber ihre Spots zu einem Aufpreis vor den erfolgreichsten Inhalten der Plattform anzeigen können.
Plötzlich sind die richtig guten Inhalte, für die Verlage und TV-Sender seit Jahrzehnten bekannt sind, wieder gefragt. Und Häuser, die vor allem mit massiver Reichweite Geld machen, können kaum erwarten, sie herzugeben und die Gelder einzustreichen. Die «New York Times», «Buzzfeed», «Vox» und eine Reihe anderer Verleger arbeiten mit Facebook zusammen.
Es gibt nicht eine Regel für alle

David Cohn, AJ+.
«Da tut sich etwas Grosses», sagt David Cohn, Inhaltechef bei AJ+, dem Innovationsarm von Al Jazeera. «Die Diskussion erinnert mich ein wenig an die Diskussion um Paywalls vor ein paar Jahren. Da wurde auch so hitzig diskutiert.» Und wenn sich aus der Paywall-Diskussion bei englischsprachigen Medien eine Lehre hat ziehen lassen, dann wohl die: Nicht für alle Medien gelten die gleichen Regeln. Während Publikationen wie die «Financial Times» mit einer strikten Paywall massive Erfolge feiern, sind andere daran gescheitert. Bei der «New York Times» war eine sanfte Paywall mit einigen kostenlosen Artikeln ein Erfolg. «Buzzfeed» hingegen dürfte so schnell kaum Geld von seinen Nutzern verlangen.
Auch in der Diskussion über fremdverwaltete Inhalte dürfte es nicht eine Regel für alle geben. Doch geschickt gemacht, können Verleger auf sozialen Netzwerken so endlich Geld verdienen und gleichzeitig mehr Nutzer anlocken. Für Ramon Iriartes «Outpost» hat sich das Experiment jedenfalls gelohnt. Sie sei eines der erfolgreichsten Formate auf Snapchat geworden, sagt er. «Es gibt so viele Plattformen mittlerweile. Unsere nächsten Schritte sind wohl Facebook und Youtube. Und dann gehts vielleicht auch ins Kabelfernsehen.»