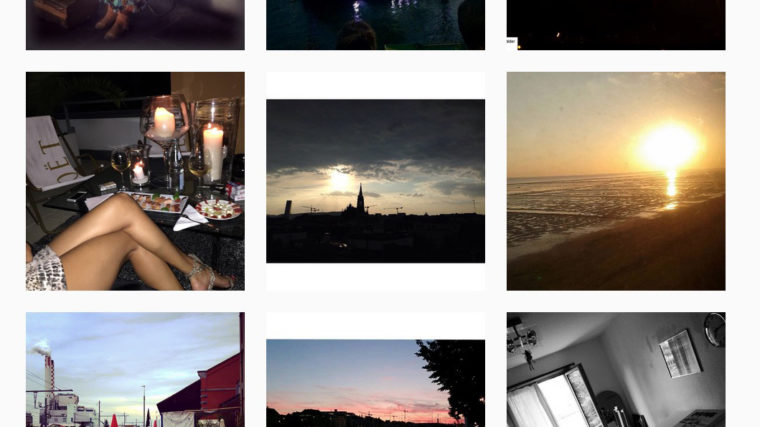Natürlich ist Instagram etwas für Banausen. Aber allem Schimpfen zum Trotz müssen sich Profis jetzt richtig anstrengen, um die besseren Bilder zu machen.
Da wollte ich einen Verriss über das Instagrammen schreiben und habe mich bei der Recherche eines andern besonnen. Es gäbe zwar einiges über den populären Bilderdienst zu schnöden, der Titel hätte in etwa geheissen: «Das Ende der Fotografie oder wie die Mütter das Knipsen kaputtmachen». Als Einstieg wählte ich eine Mami aus meinem Bekanntenkreis, die lieber ihr Smartphone statt ihre Kinder streichelt, die ihr Leben aber permanent fotografiert und auf Instagram publiziert.
Ich hätte meine fotografierenden Berufskollegen beschrieben, die aus Marketinggründen ihre professionellen Bilder zu Quadraten schneiden und mit irgendwelchen anbiedernden Hashtags versehen, um damit mögliche Kunden zu beeindrucken. Aber eben. Nach einer Weile auf Instagram und Tausenden Metern durchgescrollter Bilder ist alles anders: Die iPhone-Mutter ist passé, zig neue interessante Kanäle sind abonniert, und ich erlebe den Triumph der Fotografie als ein immer wiederkehrendes Phänomen.
Wenn ich sehe, wie Freunde, die bislang nichts mit Fotografie am Hut hatten, ihre Ausdrucksweise mit Bildern erweitern, erkenne ich, wie sehr die universelle Sprache der Fotografie unsere Kultur bereichert und allen anderen Kommunikationsmitteln überlegen ist.
Heute fotografiert der durchschnittliche Smartphone-Knipser besser als ein Fotografenlehrling vor zwanzig Jahren.
Zu Beginn der Fotografie orientierte man sich an schon bestehenden Bildern, damals eben an der seit Jahrtausenden existierenden Malerei, danach an den neu erfundenen fotografischen Bildsprachen. Da das Medium zunächst technisch aufwendig und beschwerlich war, wagten nur vermögende Abenteurer das Experimentieren, doch mit der Entwicklung immer einfacherer Kameras und erschwinglicherer Verarbeitungstechniken konnten bald auch grössere Bevölkerungsschichten fotografieren. Bildaufbau, Lichtführung, Perspektive – Begriffe, die Profis lange für sich beanspruchten, sind ins Allgemeinwissen diffundiert. Heute fotografiert der durchschnittliche Smartphone-Knipser besser als ein Fotografenlehrling vor zwanzig Jahren.
Das ist natürlich eine Herausforderung für die professionellen Fotografen. Die wettern zwar über die neue Konkurrenz und über die Omnipräsenz der Leserreporter, die ihnen bei ihrer Arbeit ständig vor der teuren Linse stehen und auch ein gutes Bild machen möchten. Doch alles Schimpfen nützt nichts. Profis müssen sich jetzt richtig anstrengen, um bessere Bilder zu machen, sonst ist es bald vorbei mit ihren Privilegien. Meldungen aus jüngster Zeit untermauern diesen Wandel: Die Manager bekannter Musikgruppen verbannen Profifotografen aus ihren Konzerten und vermarkten stattdessen Bilder, die das Publikum mit seinen Telefonkameras von den Acts schiesst.
Das Argument, dass Profis bessere Bilder machen, zieht heute nicht mehr. Jetzt haben jene Aufnahmen Erfolg, die mit den richtigen Hashtags versehen sind und mehr Likes einheimsen. Das Publikum hat gewonnen, die Künstler müssen neue Wege gehen. Gute professionelle Fotografie wird unausweichlich zu einem Nischenprodukt schrumpfen. Klick, Klick.