An Tag 3 hat sich die Stadt etwas mit dem Kunstpublikum angefreundet. Vor allem des Nachts kommt man sich näher.
Oben ist mächtig Frühstück, unten ist mächtig Kunst. Im Schaulager wird am dritten Art-Tag Brunch für geladene Gäste aufgetischt: Gipfeli türmen sich neben Schalen voll glänzendem Aufschnitt, verstreute Erdbeeren und reife Aprikosen schmiegen sich an eine grosse Auswahl Brotlaibe. Daneben liegen die kleinen Cornflakes-Schachteln, die es damals in den Skiferien am Hotelbuffet jeweils gab und um die wir uns als Kinder immer gestritten haben.
Progressive Sandalenmode am Schaulagerbrunch, irgendwas zwischen Cyborg und Gesundheitsschuh. (Bild: Matthias Oppliger)
Im Untergeschoss rätselt eine Dame derweil über die tiefere Aussage der monumentalen Skulptur «Rattenkönig» von Katharina Fritsch.
Die Dame zum Aufseher: «Sie! Wüssed Sie, was die verknotete Ratteschwänz do z bedüte hän?»
Der Aufseher: «Sie nai, laider nit. Aber luege Sie doch mol im Google noch.»
Im Garten der Kunsthalle sitzen die ersten Gäste bereits beim Mittagessen. Die Stammgäste halten sich von den langen und eng bestuhlten Tischen unter dem Kunststoffdach fern. Nur die anderen Stammgäste, die Spatzen, picken und flattern unbeirrt durch den Garten. Ihnen ist es wohl egal, ob sie von einem grellbunt beturnschuhten Galeristenfuss oder dem gut eingelaufenen Leder-Budapester eines lokalen Privatiers verscheucht werden.
Auch der Kronleuchter lässt das Kunststoffdach nicht wirklich glamouröser aussehen. (Bild: Matthias Oppliger)
«Ach, es ist doch nur noch eine riesige Geldmaschine», ächzt eine mittelalterliche Frau am Nebentisch.
«Es ist nicht mehr das Gleiche wie vor 20 Jahren», bekräftigt ihr mittelalterlicher Begleiter.
Ah, da schnödet wohl jemand über die Art, denke ich mir.
«Dieser Burgener ist doch noch kaum im Amt und schon ist es nicht mehr mein FCB», sagt die mittelalterliche Frau.
Stimmt, diese riesige Geldmaschine gibt es in Basel neben der Art ja auch noch, denke ich.
Bäumleingasse, wenig später. Ein amerikanisches Pärchen spielt mit einem gigantischen Schlüsselbund rum. Die Frau steckt ihren Kopf durch den Ring, grinst in die Kamera. Ihr Mann knipst freudig drauflos. Eine Gruppe Jogger eilt vorbei. «Schnell, durchrennen, sonst landen wir noch auf irgendeinem Selfie.»

Hat sich da jemand an den Sandbrüsten von Lena Henke vergriffen? (Bild: Matthias Oppliger)
Zwei junge Männer im Teenageralter haben auf der Pfalz ihren grossen Auftritt. Aus dem Rucksacklautsprecher dröhnt DJ Khaled, zielstrebig schlendern sie zur Mauer, platzieren sich cool.
«Ich schwör Mann, die Frauen hier sind alle voll komisch angezogen.»
«Und sie trinken Coconut Water.»
«Alter, hier ists mega langweilig. Komm, wir gehen woanders hin.»
Ähnlich irritiert wie die beiden Jungs auf das Coconut Water reagieren die Menschen auf ein weiteres Werk am Art Parcours. Im kleinen Markgräflerhof steht gleich links vom Eingang in einer kleinen Kammer ein einsamer Lautsprecher. Aus ihm dringen sporadisch Geräusche, eine Stimme sagt «Äääähh», «Ummmmmh», «Hmmmm». Die wenigen Besucher, die einen Blick in den Raum wagen, befällt angesichts seiner Leere leises Entsetzen. Beinahe panisch versuchen sie, irgendwie Kunst im Raum zu entdecken. Der Lautsprecher kann ja wohl nicht alles sein. Spätestens beim zweiten Räuspergeräusch verlassen die meisten den Raum möglichst schnell wieder.
Am Rheinsprung dröhnt verstärkte Gitarrenmusik aus einer kleinen Stube. Drinnen fuchteln, tanzen und hüpfen grellgrün gekleidete Personen rum und spielen mit Plüschkatzen. Die Hauptfigur der Performance trägt einen engen Anzug in Leopardenoptik und schlängelt sich katzenartig um die Beine der wenigen Zuschauer. Bei einem Mann geht sie noch stärker auf Tuchfühlung, reibt ihren Körper an seinem, stupst ihn mit ihrem Gesicht an. Katze halt.
Der Schmuseauftritt hinterlässt beim Betroffenen einen verstörten Ausdruck im Gesicht nebst haufenweise dunkler Schminke. Bei allen anderen Zuschauern das Gefühl, noch einmal davongekommen zu sein, und die bestätigte Meinung, dass Performance-Kunst irgendwie unheimlich ist.
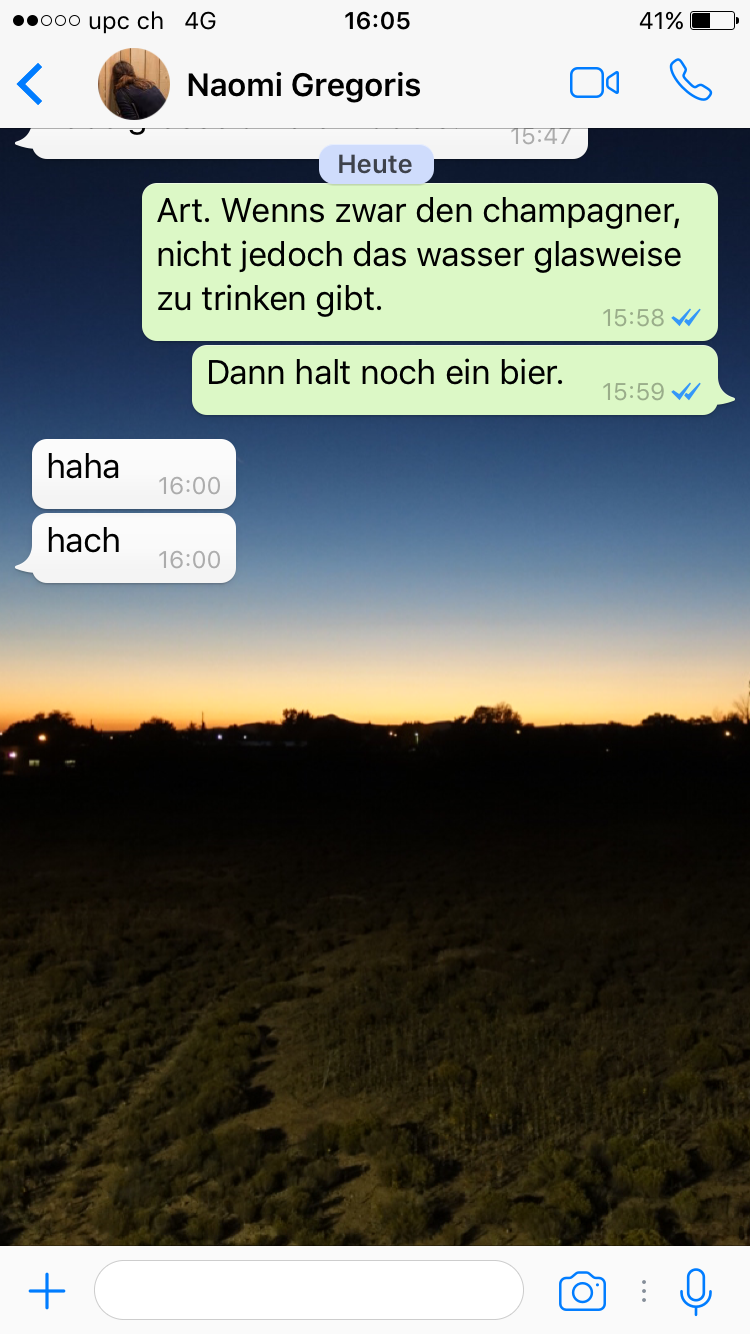
Getränkenotstand. (Bild: Matthias Oppliger)
Ein spätes Mittagessen im «Lily’s», Kunstpublikum. Eine Dame enerviert sich über den Berufsstand der Kuratoren und über schlecht verfasste Saaltexte.
«Dann sehe ich da dieses Werk und frage mich, wie es entstanden ist. Und auf dem Zettel steht nichts als gequirlte Scheisse. Was interessiert mich dieser metaphysische Quatsch, wenn ich nicht einmal verstehe, worum es in der Arbeit überhaupt geht?»
Eine andere Dame, am selben Ort, gibt sich weltläufig: «Der Thailänder benutzt zum Essen keine Stäbchen.» Gleichzeitig ist sie lokal so bewandert, dass sie weiss: «Riehen ist ein weiter Begriff.»
Auf dem Vitra Campus ist Sommerfest. Die Frauen tragen wallende Kleider oder Hosenanzüge, die Männer offensiv gemusterte Hemden. Die beiden DJs spielen tropische Beats, die Gastgeber servieren Schleckzeug. Erwachsene Männer im Anzug sitzen zufrieden auf bunten Eames-Elefantenhockern und pulen sich Überreste von klebrigen Gummierdbeeren aus den Zähnen.
«Privileged by Oppression, Oppressed by Privilege» im Ausstellungsraum Klingental. (Bild: Matthias Oppliger)
«Geld her!»
«Am schlimmsten sind die Brosamen!»
Etwa zehn Frauen und ein Mann schreien wütende Textzeilen ins Mikrofon zu dröhnend-hämmernder Musik. Im Ausstellungsraum Klingental wird gegen Privilegien und Unterdrückung angesungen. Die Performance ist zu gleichen Teilen Attitüde wie Konzert, der Raum prallvoll mit Menschen. Bierdosen-Kunstpublikum.
Der Uber-Fahrer bringt uns heim, sein Auto verfügt in der Mittelkonsole über einen Videobildschirm. Es läuft Youtube.
«Die vorher wollten italienischen Rap. Du kannst gerne etwas anderes aussuchen.»
«Schon gut, danke. Läuft wohl gut, das Geschäft, oder?»
«Ja, während der Art mache ich in einer Woche so viel Umsatz wie sonst in einem Monat. Vorhin habe ich jemanden von Basel nach Zürich gefahren.»
«Die Fahrgäste sind hauptsächlich international?»
«Zu fast 90 Prozent, würde ich sagen. Das ist aber auch problematisch, weil ich nicht wirklich mit ihnen kommunizieren kann. Die stehen dann zum Beispiel in der verkehrsbefreiten Innenstadt und warten auf mich. Die sind sich das so gewohnt von zu Hause. Und weil ich sie dort nicht abholen komme, geben sie mir dann eine schlechte Bewertung. Aber was wottsch mache.»
Überreste einer harten Galeristennacht. (Bild: Matthias Oppliger)



