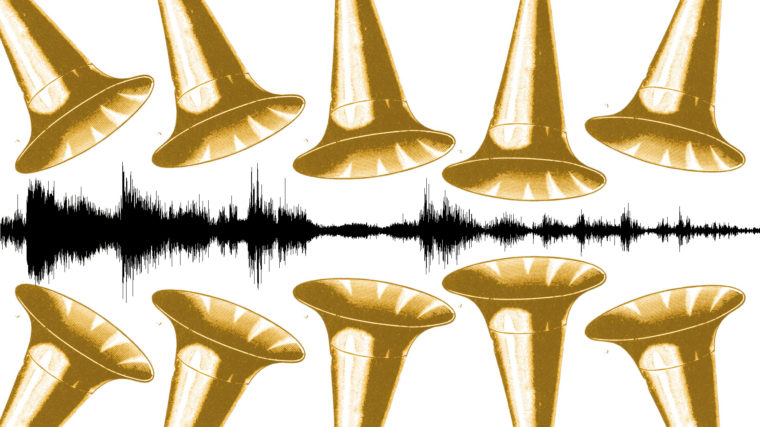Im April 2006 stand mit «Crazy» von Gnarls Barkley erstmals ein Song an der Charts-Spitze, der nur dank Download-Käufen dorthin kam. Zehn Jahre danach zeigt sich: Die Hoffnung, dass der digitale Verkauf von Musik die Industrie retten könnte, war trügerisch. Streaming-Dienste überholen die Downloads, der «Wertezerfall» von Musik hält an.
Die gebeutelte Musikbranche war elektrisiert vor zehn Jahren: Am 2. April 2006 schaffte es erstmals ein Song an die Spitze der britischen Single-Charts, der noch gar nicht zu kaufen war – zumindest nicht im Laden. «Crazy», die erste Single des Duos Gnarls Barkley, kletterte an diesem Tag ausschliesslich dank Downloadverkäufen auf den Spitzenplatz. 31’000-mal wurde das Lied, das Soulgesang mit Dancebeats und einem süffigen orchestralen Schliff à la Ennio Morricone kombinierte, per Kaufklick in der ersten Woche heruntergeladen. Nachdem der Song in der Folgewoche auch in den Läden stand, blieb «Crazy» weitere acht Wochen an der Spitze – eine schöne Geschichte für Gnarls Barkley, aber nunmehr eine Randnotiz.
Wesentlichen Anteil an der Aufbruchsstimmung hatte ein Kniff im britischen Hitparadenreglement: Erst seit März 2006, einen Monat vor der Veröffentlichung von «Crazy», wurden Downloadkäufe auch dann für die britischen Charts erfasst, wenn der physische Tonträger noch nicht zu haben war. Noch wichtiger war jedoch der psychologische Effekt: «Crazy» stand, so proklamierte es die British Phonographic Industry euphorisch nach dem Chartssturm der Single, für einen Wendepunkt im Abwärtstrend der Industrie. Endlich hatten die legalen – also gekauften – Downloadzahlen von Musiktiteln eine kritische, hitparadenrelevante Grösse erreicht. Sprich: der Kunde war bereit, für Musik, die nur aus Nullen und Einsen bestand und die man nicht ins Regal stellen konnte, zu zahlen. Anstatt sie gratis von Tauschbörsen zu saugen.
Die Zeitenwende, die keine war
Die Verkaufsstatistiken schienen den Trend zu bestätigen: In den USA, dem weltweit grössten Musikmarkt, hatte sich in den ersten drei Jahren, seit Downloadkäufe erfasst wurden, der Umsatz verdreifacht. In Grossbritannien stiegen die Downloadzahlen im selben Zeitraum gar knapp um das Vierfache, und in Deutschland wuchs der Umsatz von Musikdownloads jährlich um zehn bis zwanzig Prozent – im Spitzenjahr 2012 bezahlten deutsche Kunden über 250 Millionen Euro, um Musik digital zu erwerben.
Auf der Strecke blieben mit den Plattenläden jene Anbieter, die beim Schritt in den digitalen Verkauf übergangen wurden. Download-Plattformen, insbesondere iTunes und Amazon, wurden zu den wichtigsten Umschlagplätzen von Musik. Die Hoffnung der Industrie, dank zunehmender Qualitätssteigerung digitaler Soundformate, der Verbreitung von Smartphones und Internet-Flatrate doch noch die Kurve ins digitale Zeitalter geschafft zu haben, brachte jedoch zweischneidige Resultate hervor. Laut dem jüngsten Jahresbericht des US-Branchenverbands, der RIAA, nimmt der digitale Musikerwerb zwar fortlaufend zu und hat mit 71 Prozent des Gesamtumsatzes die CD und die LP deutlich an den Rand gedrängt. Aber 2015 war auch das Jahr, in dem Streaming-Dienste mit einem Umsatz von 2,4 Milliarden Dollar erstmals die Downloads übertrafen. Und der Trend beschränkt sich nicht auf die USA: Mittlerweile haben in 37 nationalen Musikmärkten Streaming-Nutzer zahlenmässig die Downloader überholt.
«Crazy» stand, so proklamierte es die British Phonographic Industry euphorisch nach dem Chartssturm der Single, für einen Wendepunkt im Abwärtstrend der Industrie.
Kauf oder Stream? Egal, könnte man sagen, das Geld kommt so oder so. Allerdings, und das ist aus Sicht der Musikproduzenten entscheidend, zu einem viel höheren Gegenwert. Von den 2,4 Milliarden aus den amerikanischen Streaming-Einnahmen stammt die Hälfte aus Abonnementsdiensten wie Spotify oder Apple Music, weitere 800 Millionen aus sogenannten «Sound Exchange Distributions», also Internetradios und ähnlichen Diensten, wo gegen Gebühr und Werbeeinnahmen Musikprogramme zusammengestellt werden. Die restlichen 400 Millionen Dollar kommen von kostenlosen Streaming-Plattformen, die einzig durch Werbung Geld abwerfen. Die grösste davon: YouTube.
Youtube: Das Wertegrab
Für die Industrie ist das ein Problem, das kaum zu lösen ist. YouTube, wo Milliarden Musiktitel frei herumschwirren, ist der wahrscheinlich populärste Zugang zu Musik der Gegenwart, wirft jedoch praktisch kein Geld ab. Das Phänomen wird in Fachkreisen als «Value Grab» bezeichnet – die Zahl der gestreamten Songs nimmt massiv zu, der Ertrag kann jedoch nicht eimal im Ansatz Schritt halten. Das nahezu unerschöpfliche Angebot von Musik auf YouTube bringt in den USA weniger Jahreseinnahmen als der Verkauf von Schallplatten.
Auch die Schweiz ist von dieser Entwicklung nicht ausgenommen: laut dem Jahresbericht 2015 von Ifpi Schweiz, dem nationalen Ableger des Weltverbands der Musikindustrie, machen Streaming-Dienste mittlerweile zwanzig Prozent des Umsatzes aus. Auf Kosten der Downloads, aber auch der physischen Tonträger: deren Verkaufszahlen sind seit 2010 fast um zwei Drittel geschrumpft.
«Ich bin zuversichtlich, dass künftig mehr Geld aus der digitalen Musiknutzung zu den Labels und zu den Musikern fliessen wird.»
Was der Aufstieg der Streaming-Dienste für Musikschaffende bedeutet, ist noch schwer abzuschätzen. Die Margen pro Stream sind bei den grossen Anbietern wie Spotify klein und bewegen sich pro gehörtem Song zwischen 0,1 und 0,6 Rappen. Allerdings stehen gerade Vertreter der Independent-Szene den neuen Kanälen alles andere als negativ gegenüber. So bezeichnete Andreas Ryser, Präsident des Verbands unabhängiger Schweizer Musiklabels (IndieSuisse) im Berner «Bund» Streaming-Dienste als die einzige funktionierende digitale Lösung der Zukunft.
«Spotify ist der Marktleader, er hat etwa 100 Millionen Nutzer, davon haben circa 30 Millionen ein Bezahl-Abo. Es gibt also noch Luft nach oben. Ich bin zuversichtlich, dass künftig mehr Geld aus der digitalen Musiknutzung zu den Labels und zu den Musikern fliessen wird.»
Vorbild Schweden
Wie das geht, macht Schweden vor: Dort hat Spotify Verträge mit lokalen Telekommunikations- oder Autofirmen abgeschlossen, um den Content direkt an die Nutzer zu bringen. Zudem hat das skandinavische Land auch den Streaming-Verkauf in die Hitparadenwertung integriert, was die Promotion ankurbelt. Die Folge: der Musikumsatz ist von 2008 bis 2015 um umgerechnet 50 Millionen Franken gewachsen, wovon mit 70 Prozent der Grossteil aus dem digitalen Verkauf kommt – und davon wiederum über 90 Prozent aus Abonnementsdiensten wie Spotify.
Auch bei Ifpi Schweiz begegnet man Streaming-Diensten eher gelassen: «Neue Musik- oder Nutzungsformate lösen ihre Vorgänger ab, das ist ein bekanntes Phänomen», sagt Philipp Truniger von Ifpi Schweiz. Gründe dafür: schnellerer Internet-Zugang, weniger Speicherplatz auf Endgeräten, dafür massenhaft Platz im virtuellen Raum, den Clouds. «Der Besitz wird ersetzt durch den Zugang», so Truniger.
Mit Prognosen hält sich Truniger allerdings zurück, und tatsächlich ergibt das Szenario der Ablösung von Download-Käufen durch Streaming-Dienste kein vollständiges Bild. In Deutschland etwa ist der physische Verkauf mit rund 70 Prozent Anteil am Gesamtumsatz noch immer marktführend, in Japan, dem zweitgrössten Musikmarkt der Welt, sind es laut Ifpi sogar 80 Prozent. Deuten lassen sich diese Zahlen in zwei Richtungen: Entweder ist die Treue zum Tonträger gerade in diesen grossen Märkten weiterhin stark – oder, was wahrscheinlicher ist: Der Grossteil des Online-Musikkonsums wird in den Verkaufsstatistiken kaum erfasst, weil er keinen Ertrag abwirft.
Stream-Teaser als Marketingstrategie
Was tun? Dagegen gebe es für die Industrie «erkennbare Marketingstrategien», so Truniger: Etwa, dass Musiker und Plattenfirmen ihre Neuheiten im Vorab exklusiv auf einem Streaming-Dienst anbieten, bevor der digitale und physische Verkauf lanciert werden. Zumindest gibt es Beispiele in den USA in diese Richtung, während in Europa noch häufig der Tonträger selbst – die LP, die CD – zuerst veröffentlicht und die reinen digitalen Formen zeitgleich oder nachgeliefert werden. «Insgesamt gilt es festzuhalten, dass die Streaming-Angebote noch in der Wachstumsphase, in ihrer Funktionalität und Bedienbarkeit aber bereits so fortgeschritten sind, dass künftig wohl mehr Geld aus der digitalen Musiknutzung zu erwarten ist.»
Nicht verändert hingegen hat sich, so Truniger, das «alte Klagelied» der Musikindustrie: die Piraterie. Laut dem Globalbericht von Ifpi für 2015 nutzen geschätzte 20 Prozent aller Internet-User «unlizenzierte Dienste». Dass diese Zahl nicht weiter wachsen oder sogar schrumpfen werde, glaubt mittlerweile selbst die Ifpi nicht mehr. Streaming-Dienste werden zunehmend das «Herz» des internationalen Musikmarktes darstellen, so der positive Ton des Globalberichts für 2015.
Weniger aufmunternd hingegen klingt die nachgeschobene Begründung: diese Veränderung sei das Resultat einer jungen Generation von Musikhörern, denen es an «Erfahrung im Musikbesitz mangle, und die deshalb weniger an traditionellen Formen von Musikbesitz hängen». Will heissen: sie sammeln Musik nicht mehr, weder im Regal noch auf der Festplatte, sondern sie hören sie nur noch. Und zwar dort, wo der Zugang am schnellsten und die Kosten am tiefsten sind.