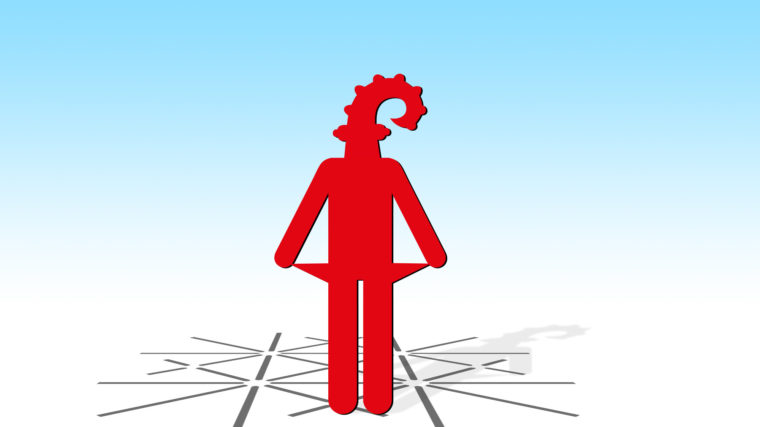Am 5. Juni wird im Baselbiet über Beiträge an die Pensionskasse der Universität abgestimmt. Im Abstimmungskampf geht es aber einmal mehr vor allem um die getrübte Partnerschaft, während das eigentliche Thema lediglich eine Nebenrolle spielt.
Es sind nicht die aktuellen Budgetkürzungen im Kulturbereich, die Esther Roth gegenwärtig am meisten Kopfzerbrechen bereiten. Die neue Baselbieter Kulturbeauftragte blickt mit grosser Sorge auf den Abstimmungssonntag vom 5. Juni 2016. Um Kulturpolitik geht es dann aber nicht. Oder höchstens indirekt – aber dies wiederum mit nachhaltigen Folgen.
Konkret stehen Beiträge an die Pensionskasse der Universität beider Basel zur Debatte. Oder im schönsten Verwaltungsdeutsch ausgedrückt: «Umsetzung der Pensionskassengesetz (PKG)-Reform beim Vorsorgewerk der Universität Basel in der Pensionskasse des Kantons Basel-Stadt; Sicherung der Umsetzung der Strategie der Universität; Zusatzfinanzierung 2017 bis 2021». Namentlich geht es um einen Betrag von 15 Millionen Franken, den das Baselbiet an die Uni Basel leisten müsste, verteilt über einen Zeitraum von fünf Jahren. Gegen dieses partnerschaftliche Geschäft hat die Baselbieter SVP das Referendum ergriffen.
«Absurditätspreis»
SVP-Sprecher Hanspeter Weibel bezeichnete das Geschäft in der Landratsdebatte vom vergangenen Dezember als Favorit für einen allfälligen «Absurditätspreis». Konkret kritisierte er den Umstand, dass unter dem Strich nicht die Zusatzfinanzierung der Pensionskasse, sondern der 80-Millionen-Franken-Deal mit dem Kanton Basel-Stadt im Vordergrund stehe. Ganz unrecht hat der Landrat damit nicht. Allerdings trägt seine Partei selber massgeblich zu einer Verschiebung der Debatte auf diesen Nebenschauplatz bei.
Tatsächlich ist die Zusatzfinanzierung eine der Bedingungen, die der Kanton Basel-Stadt an die Gewährung des 80-Millionen-Beitrags an den finanziell angeschlagenen Partnerkanton geknüpft hat. Lehnt das Baselbiet seinen Beitrag an die Pensionskasse ab, würden die Basler Beiträge gestrichen – mit der Folge, dass Baselland den Universitätsvertrag und den Kulturvertrag wie ursprünglich geplant kündigen würde. Dies wäre wiederum sehr wohl im Sinne der Baselbieter SVP, die sich vom Deal mit Basel-Stadt eh über den Tisch gezogen fühlt.
Worum gehts bei der Abstimmung konkret?
Als Folge der niedrigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt wurde der technische Zinssatz bei der Pensionskasse der Uni (wie auch bei den Pensionskassen der Kantone Basel-Stadt und Baselland) von 4 auf 3 Prozent gesenkt. Das ist ein logischer Schritt, denn mit dem technischen Zinssatz schätzten die Kassen die Höhe ihrer künftigen Einnahmen ein. Wenn nun die erwarteten Einnahmen sinken, ist für die Sicherstellung der Vorsorgeleistungen ein höheres Kapital nötig.
Die Universität sieht sich nun aber ausserstande, die Ausfinanzierung ihrer Pensionskasse aus eigener Kraft zu stemmen. Also sollen die beiden Trägerkantone mit Beiträgen von je 15 Millionen Franken in die Bresche springen. Ursprünglich wollte sich die Uni mit 61 Millionen Franken unter die Arme greifen lassen. Doch die beiden Kantone kürzten ihre Beiträge auf rund die Hälfte. So müssen die Angestellten der Uni (rund 2900 Vollzeitstellen) – anders als die Staatsangestellten der beiden Basel – selber einen namhaften Beitrag leisten.
Pensionskasse als Stellvertreter-Schlachtfeld
Der Reformbedarf der Uni-Pensionskasse wird im Abstimmungskampf an und für sich nicht bestritten. Die SVP vertritt aber die Meinung, dass die Uni dies vollständig aus eigenen Kräften stemmen müsste. «Wir sollen das im eigenen Kanton mühsam und in harten politischen Auseinandersetzungen Eingesparte an eine mit Finanzmitteln hervorragend ausgestatte Institution im Kanton Basel-Stadt überweisen», schreibt die SVP in den Abstimmungsunterlagen.
Aus diesem Satz geht hervor, dass sich die SVP einmal mehr auf Grabenkämpfe zwischen dem «reichen und geldgierigen» Stadtkanton und dem «geplagten» Landkanton einlässt. Auf den Abstimmungsplakaten ist entsprechend ein gefrässiges Monstrum im Kleid eines Baslerstabs zu sehen, das mit spitzen Zähnen Geld aus dem Baselbiet verschlingt. Davon, dass das Geld an die gemeinsame Universität geht und nicht an den verhassten Partnerkanton, ist in der SVP-Kampagne keine Rede.
Was geschieht bei einem Nein?
Der Umstand, dass bei einem Nein zur Finanzierung der Uni-Pensionskasse auch der 80-Millionen-Deal mit Basel-Stadt platzen würde, sollte eigentlich auch die SVP in Bedrängnis bringen. Doch die Partei der einfachen Rezepte lässt sich nichts anmerken. Sie weist vielmehr darauf hin, dass alleine mit der Kündigung der Immobilienvereinbarung im Rahmen der Uni-Trägerschaft mehr eingespart werden könnte als der Jahresbeitrag in Höhe von 20 Millionen Franken, die Basel-Stadt «aus der Portokasse» an Baselland überweisen würde.
Das Problem bei dieser Rechung ist aber, dass Baselland die Kündigungsfrist für den Uni-Staatsvertrag bis Ende 2015 ungenutzt verstreichen liess. Aktuell wäre eine Kündigung frühestens auf 2021 hin möglich. Baselland müsste also mindestens fünf Jahre weiterhin die vollen Beiträge zahlen, ohne auf die Entlastungsbeiträge aus Basel-Stadt zurückgreifen zu können. Und die Uni müsste, um die Pensionskasse vollständig mit eigenen Mitteln sanieren zu können, trotzdem sparen.
Nicht so gut gehts den Kulturinstitutionen
Der Kulturvertrag zwischen den beiden Basel ist indes mit weniger grosszügigen Kündigungsfristen ausgestattet als der Universitätsvertrag. Zwar liess Baselland auch hier die Frist bis Ende 2015 verstreichen. Die Kündigungsfrist beträgt aber lediglich ein Jahr, so dass es den betroffenen Kulturinstitutionen möglicherweise bereits Ende 2017 an den Kragen gehen könnte. Das ist denn auch der Grund, warum die Kulturbeauftragte Esther Roth dem 5. Juni mit Sorgenfalten im Gesicht entgegenblickt.