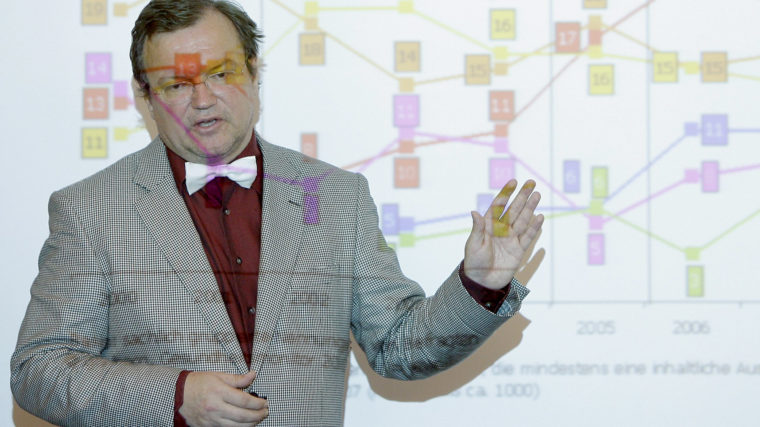Umfragen zu politischen Haltungen und Entscheidungen sind omnipräsent. Doch die Methoden und Interessen der Befrager bleiben oft im Dunkeln.
Wer Umfragen produzieren und verbreiten könne, verfüge über Macht. So lautet die Warnung, nachdem gegenüber der Auswertung des Stimmverhaltens bei der Masseneinwanderungsinitiative vor gut einem Monat Zweifel aufgekommen sind. Es ging um den aufschreckenden Befund, dass die jungen Bürgerinnen und Bürger in dieser Abstimmung, die sie selbst in hohem Masse betrifft, mit Abwesenheit geglänzt hätten.
Die Mitteilung hat sogleich zu staatsbürgerlichem Stirnrunzeln geführt. Sekundär hat sie aber auch die Frage aufgeworfen, ob die Umfrage nicht mit einer fragwürdigen Methode erhoben worden sei, weil im Sample (der Stichprobe) der Befragten ältere Festnetz-Kunden stärker berücksichtigt worden seien als jüngere Handy-Abonnenten.
Inzwischen ist aus der Debatte um die angebliche Stimmfaulheit eines tendenziell gerne kritisch beäugten Alterssegments eine Grundsatzdiskussion um Qualität und Wesen solcher Umfragen geworden. Und weil man Probleme gerne personalisiert, geriet fast zwangsläufig der Berner Politologe Claude Longchamp ins Visier. Der bekannte «Mann mit der Fliege», Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident des Forschungsinstituts gfs.bern, ist in Sachen Wahlen und Abstimmungen mit den Jahren so etwas wie der Politwetterfrosch der Nation geworden. Zugleich wird er wegen seiner starken Stellung als Haus- und Hofexperte der SRG kritisiert.
Zahlenfetischismus um das Faktische
An Longchamp kann man einige Probleme aufzeigen, aber Longchamp ist nicht das Problem. Das Problem sind die Umfragen an sich oder – noch weiter gefasst – unser Hang zum Quantifizieren, unsere Einstellung zu Zahlen, also auch zu den Statistiken, die in wachsendem Mass produziert und serviert werden. Es gibt den Zahlenfetischismus um das Faktische. Wir dürfen uns daran erinnern, dass «factum» eigentlich das Gemachte ist und dass Fetischismus von «facticius» stammt und das Nachgemachte meint. Das Gemachte und Nachgemachte wird aber als essenzieller Gegenstand aufgefasst, ihm wird entsprechende Verehrung entgegengebracht. Krasse Beispiele des fragwürdigen Umgangs mit dem, was «Fakt» sei und tatsächlich bloss suggestiv zusammengestellte Zahlen sind, liefert immer wieder die SVP-Agitation, die mit ihren Hochrechnungen aufzeigt, dass in X Jahren die Schweizer in ihrer Schweiz nur noch eine Minderheit sein werden.
An sich ist gegen Bemühungen, Mengenverhältnisse in Zahlen zu erfassen nichts zu sagen. Das Problematische daran ist aber, dass in der Regel nur die Ergebnisse vermittelt und aufgenommen werden und nicht zugleich dargelegt wird, wie sie zustande gekommen sind. Das Tempo der Nachrichtenvermittlung und -aufnahme lässt keinen Raum für solche Überlegungen. Als aufgeklärte Menschen sollte uns gerade das aber interessieren.
Der kritische Konsument möchte wissen, wie ein Umfrageresultat zustande kam und insbesondere wer die Untersuchung finanziert hat.
Kein Tag ohne Zahlenangaben zu irgendwelchen Problembereichen. Damit verbunden ist die Anerkennung, dass die bezifferten Haltungen von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung sind. Jüngstes Beispiel sind die Angaben aus der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake),wie viel Stunden und Minuten im Tag weibliche und männliche Menschen Haushaltsarbeit verrichten. Aber kein Wort dazu, wie das Bundesamt für Statistik zu diesen Zahlen gekommen ist.
Ein paar Tage zuvor hat uns die Nachricht erreicht, dass eine Forschungsstelle der Universität St. Gallen die Haltungen zu erneuerbaren Energien abgefragt und dabei festgestellt habe, dass die Bereitschaft, solche Energie zu nutzen, stark (vielleicht von 41 auf 46 Prozent?) gestiegen sei. Eine schöne Grafik mit schönen Resultaten gelangte über das Abendfernsehen ins Haus. Wie aber waren die Befunde gewonnen worden? Für Erklärungen dazu gab es weder Zeit noch bestand Interesse. Der vermittelte Eindruck war bereits selbst Realität. Weil eine Uni dahintersteckte, konnte man eine erhöhte Glaubwürdigkeit annehmen. Aber sicher ist auch das – nicht mehr. Als kritischer Konsument würde man gerne wissen, wie das Resultat zustande kam und insbesondere wer die Untersuchung finanziert hat.
Aufgeregtes Umfragetheater als Spannungskiller?
Neben den vielen privat unternommenen und von den grossen Printmedien als aufmerksamkeitsteigerndes Instrument eingesetzten Umfragen nehmen die eingangs angesprochenen Politumfragen zu offiziellen Wahlen und Abstimmungen eine besondere Stellung ein. Da geht es um die «Wurst», das heisst um politisch verbindliche Entscheide. Und da geht es um die Frage, welchen Einfluss die im Vorfeld eines Urnengangs publizierten Umfrageresultate auf das Wahl- und Abstimmungsverhalten haben, sowie um die Frage, wie das dann vorliegende Resultat in der Folge zu beurteilen sei.
Die vorgängigen Trendstudien wie die nachträglichen Abklärungen zum Stimmverhalten sind vom ehemaligen Bundesratssprecher und Vizekanzler Oswald Sigg jüngst in der NZZ grundsätzlich kritisiert worden. Für ihn stehen Vor- und Nachbefragungen von Stimmberechtigten im Widerspruch zum geltenden Abstimmungsgeheimnis. Zudem ist Sigg der Meinung, dass Volksabstimmungen wegen des «aufgeregten Umfragetheaters» an Spannung verlieren würden, ja sie würden sogar langweilig.
Diese Sorge mag bei deutlich unterschiedlichen Zustimmungs- und Ablehnungsbefunden berechtigt sein. Zeigen die Umfragen jedoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, können sie auch das Gegenteil von Langeweile bewirken. Zudem könnte man einen leicht positiven Effekt auf die Stimmbeteiligung vermuten, weil die Bürgerinnen und Bürger so nach der Zustellung des Abstimmungscouverts zusätzlich darauf aufmerksam gemacht werden, dass gemeinsam zu fällende Entscheide bevorstehen.
Volkszorn gegen verzögerte Resultate
Anerkennen muss man, dass die Trendstudien zur Frage, wie der nicht stimmfaule Teil des «Souveräns» – im Jahresdurchschnitt von 2013 waren es 46,6 Prozent von rund 5 Millionen Stimmberechtigten – entscheiden würde, wenn der Urnengang schon «am nächsten Sonntag» wäre, bemerkenswert zuverlässige Resultate liefern. Es gehört aber zur Kultur solcher Umfragen, dass man warnend auf Fehlermargen von plus/minus zwei Prozent hinweist.
Zwischen dem Vorher und dem Nachher gibt es die bei der Schliessung der Abstimmungslokale präsentierten und ebenfalls erstaunlich zuverlässigen Hochrechnungen. Selbst als politisch interessierter Zeitgenosse habe ich allerdings nie begriffen, warum man die Resultate noch am gleichen Abend und vor den definitiven Auszählungen haben will. Und warum sich einzelne Gemeinden, vielleicht in abgelegenen Gebieten (sofern es diese noch gibt), dem Volkszorn beziehungsweise der Medienschelte aussetzen, wenn ihre nicht unverzüglich abgelieferten Resultate die Bekanntgabe der Endergebnisse etwas verzögern.
Es gibt ein legitimes Interesse zu erfahren, welche Haltungen die Geschlechter, Alterskategorien oder Berufsgattung eingenommen haben.
Es mag erstaunen, dass man sich im Rückblick, wenn gemäss der schweizerischen Agrarsprache «der Mist geführt» ist, wenn also die Resultate feststehen und von keiner «Geiss» mehr weggeschleckt werden können, für die Zusammensetzung des Ergebnisses und die darin steckenden Motive interessiert. So genannte Exit-poll-Befragungen klären seit bald 40 Jahren in den Wochen nach den Urnengängen mit repräsentativen Stichproben ab, wer wie und warum so oder anders abgestimmt hat.
Meine Skepsis gegenüber der Zuverlässigkeit gewisser Angaben dieser Erhebungen erlebte 2009 eine Bestätigung, als die Annahme der Anti-Minarett-Initiative von Befragten damit erklärt wurde, dass man überhaupt nichts gegen die in der Schweiz lebenden Muslime habe und ein Zeichen gegen den internationalen Islam habe setzen wollen. Diese Erklärung war mit höchster Wahrscheinlichkeit von der vehementen Kritik beeinflusst, die sogleich nach Bekanntgabe des Abstimmungsresultates einsetzte und sich entsprechend auf die danach einsetzende Befragung auswirkte.
Die Bedenken, dass mit den Umfragen das Stimmgeheimnis verletzt wird, teile ich jedoch nicht. Bei vielen Vorlagen ist es von legitimem Interesse zu erfahren, ob eher Frauen oder eher Männer, ob diese oder jene Alterskategorie, Berufsgattung et cetera eine zustimmende oder ablehnende Haltung eingenommen hat. Das Abstimmungsgeheimnis (dessen Fehlen man in der Landsgemeinde als der ursprünglichen Versammlungsdemokratie übrigens kaum bemängelt) sollte die einzelnen Wahl- und Stimmberechtigten vor möglichen Benachteiligungen wegen ihres Stimmverhaltens schützen. Sind die Auskünfte anonymisiert, kann diese Sorge entfallen. Die Abfragerei muss sich aber damit zufrieden geben, was in der Selbstdeklaration angegeben wird – und die muss bekanntlich nicht immer mit dem tatsächlichen Verhalten übereinstimmen.