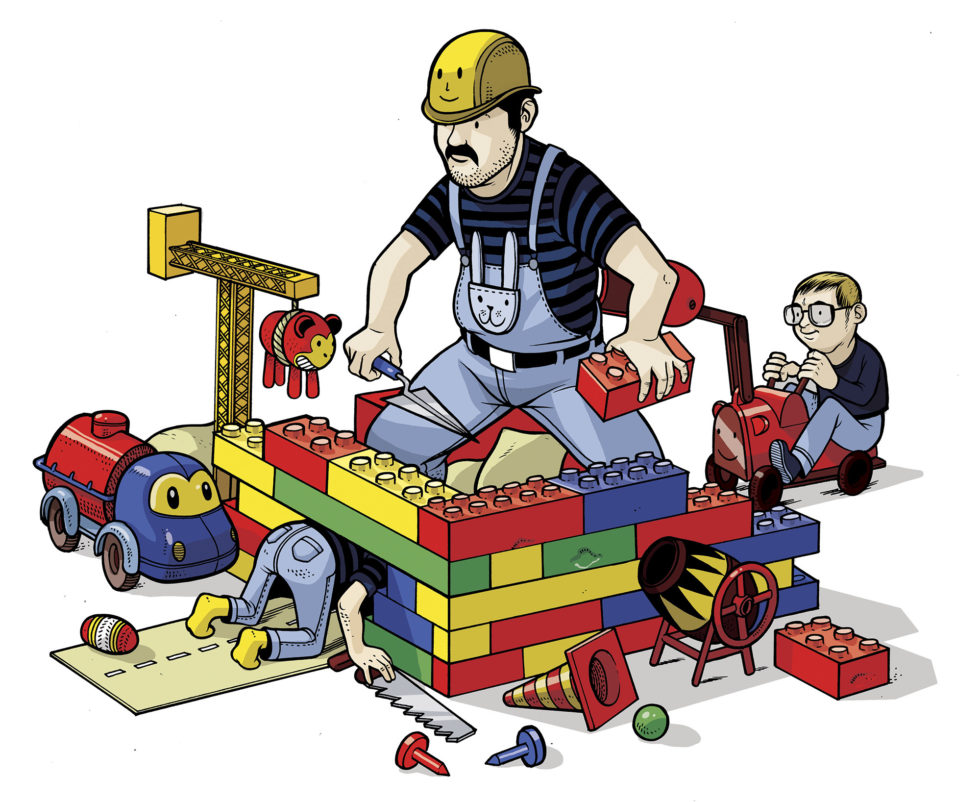Es werden wieder mehr Kinder geboren, und bereits ist von einem neuen Babyboom die Rede. Sie denken, das ginge Sie nichts an? Da könnten Sie sich täuschen.
Babyboom, das ist ein Begriff aus der Vergangenheit. Genauer, aus den 1950er-Jahren. In jener Zeit des wachsenden Wohlstands in ganz Europa und des unerschütterlichen Glaubens an denselben setzten die Menschen gerne Kinder in die vielversprechende Welt. Insofern ist kaum vorstellbar, dass sich heute – da man allerorts nur noch von ökonomischen und ökologischen Krisen spricht – ein neuer Babyboom abzeichnen soll. Und doch gibt es diese Signale.
Gemäss Forschern vom Max-Planck-Institut im deutschen Rostock, die 37 entwickelte Länder mit bisher stetig sinkenden Geburtenraten untersucht haben, zeichnet sich eine Trendwende ab. Dazu gehört auch die Schweiz: Seit 2005 habe die Zahl der Geburten in der Schweiz Jahr für Jahr zugenommen, berichtet das Bundesamt für Statistik. 2012 kamen 81 500 Kinder zur Welt, 700 mehr als im Jahr davor und 1200 mehr als 2010.
Besonders gross ist der Anstieg in der Stadt Zürich, wo im letzten Jahr fast 5000 Kinder geboren wurden – so viele, wie seit 1968 nicht mehr. Aber auch in Basel freut man sich über steigende Geburtenzahlen. Sie sind zwar nicht derart angestiegen wie in Zürich, aber die Kurve zeigt auch hier aufwärts.
Auch Basel verzeichnete im letzten Jahr so viele Neugeborene wie seit 1974 nicht mehr.
Im Bethesda-Spital kamen letztes Jahr 1132 Kinder zur Welt, 175 mehr als 2011, und Direktor Thomas Rudin sieht aufgrund der Geburtenzahlen im ersten Quartal des laufenden Jahrs «zuversichtlich» in die Zukunft. Zumal das Bethesda derzeit noch eine neue Geburtsklinik baut. Dank dieser – sie wird Ende August eröffnet – rechnet Thomas Rudin mit einer weiteren Steigerung. In der Frauenklinik des Basler Unispitals wurden im letzten Jahr 2358 Kinder geboren, im Kantonsspital Baselland waren es insgesamt 1320 Kinder. An beiden Orten heisst es, das seien ungefähr gleich viele wie im Vorjahr.
Die Anzahl der Geburten in den Kliniken sagt allerdings nur bedingt etwas darüber aus, ob tatsächlich mehr Kinder in Basel leben, denn der Ort der Geburt muss nicht zwingend mit dem Wohnort übereinstimmen. Doch Christa Moll vom Statistischen Amt des Kantons Basel-Stadt bestätigt, dass seit einiger Zeit eindeutig wieder mehr Kinder zur Welt kommen als in den Vorjahren. In Zahlen: Basel konnte im vergangenen Jahr 2018 Neugeborene verzeichnen, so viele wie seit 1974 nicht mehr.
Eine Gefühlssache
Fragt sich nur, was heute anders ist als Ende der 1960er-, Anfang der 1970er-Jahre, als die Geburtenrate stetig sank und sich der Begriff «Pillenknick» als etwas simple Erklärung für dieses Phänomen etablierte. Schliesslich verhüten die Menschen auch heute noch, die Mehrheit der Kinder sind also Wunschkinder. Sucht man nach Antworten direkt bei werdenden Eltern oder solchen, die es unlängst geworden sind, hört man – nach einem ersten erstaunten Stirnrunzeln über die Frage nach dem Warum – stets etwa folgendes: Es sei schon immer klar gewesen, dass sie einmal Kinder haben wollten.
Belinda (37) und Christian Bihari (39) aus Füllinsdorf reagieren nicht anders. Eine Gefühlssache sei das, meinen sie beide. Er: Es habe irgendwie mit dem Gedanken, mit der Faszination zu tun, dass etwas aus ihnen beiden entstehe. «Die Frage Kinder ja oder nein stand nie im Raum», sagt sie, «einzig die, wie viele es denn sein sollen.» Die Biharis erwarten derzeit das dritte Kind, die beiden älteren sind 6 und 8 Jahre alt. Der Wunsch nach einem dritten sei immer schon dagewesen, sagt Belinda, aber vor allem sie habe ihn immer wieder hinausgeschoben.
Solange die beiden anderen Kinder noch klein gewesen seien, habe sie sich ein drittes nicht vorstellen können. Doch seit die Tochter in den Kindsgi gehe und der Sohn zur Schule – «gabs Luft». Und Platz haben sie im Einfamilienhaus, das sie sich vor fünf Jahren gekauft haben, auch genug. Die Biharis entsprechen dem Bild der klassischen Mittelstandsfamilie, und sie haben sich auch für die klassische Rollenverteilung entschieden. Er arbeitet als IT-Architekt bei einem der beiden grossen Pharmakonzerne in Basel. Sie, die in Deutschland Touristik studiert hatte, ist zu Hause bei den Kindern. Das stimme für sie beide. Sein Verdienst ist gut genug, dass sie sich das leisten können.
Ein «kleines eigenes Standbein» hat sich Belinda allerdings inzwischen aufgebaut: Als «KuchenDiva» backt sie auf Bestellung Motivkuchen. Dabei ist der Spassfaktor und der Umstand, dass sie diese Arbeit zu Hause machen kann, wichtiger als der zusätzliche Verdienst. Selbstverständlich schätzten sie einen gewissen Lebensstandard, sagen sie. Aber Geld verdienen und Dinge kaufen sei nicht alles, «Kinder, eine Familie zu haben, das ist für mich der wirkliche Sinn des Lebens», fügt Christian Bihari an.
Die Generation Golf hat inzwischen auch die immateriellen Werte entdeckt.
Er ist mit dieser Haltung nicht allein in seiner Generation. Obwohl diese zu Beginn des neuen Jahrtausends noch als die ich-bezogene «Generation Golf» beschrieben wurde, die Materielles über alles andere erhebe. Doch das hat sich offensichtlich geändert. So ergab 2008 eine Studie des Gottlieb-Duttweiler-Instituts (GDI) über die aktuellen Statussymbole, dass immaterielle Werte wieder einen sehr hohen Stellenwert haben.
«Besonders hoch oben», sagt Studienleiterin Mirjam Hauser, «steht die Partnerschaft und die Familie.» Generell beobachte man eine veränderte Haltung in der Gesellschaft: «Alles, was knapp ist, erlangt wieder mehr Bedeutung.» Das gelte für die beschränkten Ressourcen der Natur ebenso wie für die in den letzten Jahren immer weniger gewordenen Kinder. Heute bekennen sich auch Männer offen zu ihrem Kinderwunsch, während ein solcher früher eher als typisch weiblich gegolten hat. «Die Männer sind stolz, Kinder zu haben, und zeigen sich mit ihnen», sagt Hauser.
Fest steht ebenfalls, dass sich die Männer seit einigen Jahren stärker an der familiären Arbeit beteiligen. Das ist wohl ein zusätzlicher Grund für die neu erwachte Lust, eine Familie zu gründen. Die Frauen müssen die Verantwortung für Kindererziehung und Haushalt nicht mehr allein tragen. Ausserdem – oder vielleicht sogar vor allem: Frauen wird nicht mehr selbstverständlich die Entscheidung «Kind oder Beruf» abverlangt. Das Stigma der Rabenmütter, das man erwerbstätigen Müttern bis anhin aufgedrückt hat, verblasst zusehends.
Dass zwischen besseren Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und der erhöhten Geburtenzahl ein Zusammenhang besteht, ist deshalb wohl nicht von der Hand zu weisen. Das jedenfalls dürfte erklären, weshalb die Städte, die diesbezüglich klar mehr Angebote haben als ländliche Gemeinden, für Familien wieder so attraktiv geworden sind.
Es gibt viel zu tun
Wollen die Städte attraktiv bleiben für junge Familien mit zwei und mehr Kindern, dürfte dies in verschiedenster Hinsicht Auswirkungen auf künftige Planungen haben. Beim Wohnungsbau sowieso, aber auch im öffentlichen Verkehr, zum Beispiel bei den Trams. Nein, es geht nicht darum, dass man Massnahmen ergreifen muss, um erwachsene Fahrgäste vor fröhlich plappernden Kindergartenklassen zu schützen. Sondern es geht um Investitionen in die Infrastruktur. Wie oft hört man Erwachsene wegen der «blöden Kinderwagen» schnauben und schimpfen. Wie oft müssen Mütter und Väter in Stosszeiten entweder zu Fuss auf den Heimweg oder warten, bis ein schwach besetztes Tram kommt. So nach und nach müssen sich die Basler Verkehrsbetriebe Gedanken machen, wie sie auf die steigenden Geburtenzahlen und die Vermehrung der Kinderwagen reagieren wollen.
Aber andere Bereiche gilt es ebenso zu überdenken. Sparen bei der Bildung? Kein Thema mehr. Um die Tagesschule als Modell der Zukunft wird man früher oder später nicht herumkommen. Und auch beim Ausbau von Krippenplätzen muss noch – Familienartikel hin oder her – gehörig Gas gegeben werden. Es reicht nicht, den Anspruch auf einen Platz via Verfassung zu garantieren, wie das der Kanton Basel-Stadt tut. Man muss diese Plätze auch haben.
Nicht zu vergessen das Ärgernis, dass der Weg zu einem subventionierten Platz in Basel zwingend über die jetzt schon überforderte Tagesheim-Vermittlungsstelle führt. Eine stetig grösser werdende Nachfrage wird dieses System endgültig zum Einsturz bringen, ein Wechsel zu Betreuungsgutscheinen wird – hoffentlich– unausweichlich. Bern machts vor.
Die düsteren Prognosen für unser Rentensystem könnten über den Haufen geworfen werden.
Man kann die Vision einer kinderreichen Gesellschaft aber noch weiterspinnen: Zum einen könnten die düsteren Prognosen für unser Rentensystem über den Haufen geworfen werden, was auch Kinderlosen nur recht sein kann, und zum anderen wird im Alltag von uns allen alles ein bisschen anders, wenn Kinder wieder eine bemerkbare Grösse sind.
Die einen mögen jetzt aufschreien und auf die fürchterlich verzogenen Plagen von heute hinweisen, die laut und frech genug seien. Ach was, behaupte ich. In den vergangenen Jahrzehnten sind die Kinder immer mehr aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden – in ihre eigens für sie eingerichteten Räume und Zonen. Die Erwachsenenwelt wurde kaum noch gestört. Und wenn sie doch gestört wurde, fiel die Reaktion heftig aus.
Wer ist hier schwierig?
Zwar gab es schon früher Eltern und Lehrer und Nachbarn und Hauswarte, die die Kinder drangsalierten, das alles soll keineswegs idealisiert werden. Aber in den letzten Jahren mussten sich immer häufiger Polizisten und Gerichte mit Streichen von Kindern und Jugendlichen befassen. Sogar Kinderlärm wurde zum Thema für die Richter, Anwohner klagten gegen Spielplätze und rekurrierten gegen geplante Kindertagesstätten. Vor anderthalb Jahren wurde deswegen sogar das Bundesgericht bemüht, das dann in einem wegweisenden Urteil festlegte, dass Lärm von spielenden Kindern während bestimmten Zeiten den Nachbarn auch in einer ruhigen Wohnzone zuzumuten sei.
Als gute und gesunde Kinder gelten heute diejenigen, von denen man möglichst nicht merkt, dass es sie gibt. Begriffe wie verhaltensauffällig oder verhaltensoriginell sind allgemein gebräuchlich und werden nicht einmal mehr hinterfragt. Stattdessen schickt man unzählige Kinder in die Therapie und – wenn das nicht das erhoffte Ergebnis bringt – stopft man sie mit Psychopharmaka voll. Darf ein Kind nicht auffallen? Ist es denn nicht gerade diese Unbändigkeit, was ein Kind von einem Erwachsenen unterscheidet? Da können Letztere sich noch so als ewig jugendliche Kindsköpfe ausgeben, es wirkt bemüht, je älter sie werden.
Sind Kinder nicht die «wahren Anarchisten», wie der singende Ex-Schauspieler Herbert Grönemeyer sie in seinem Hit «Kinder an die Macht» beschreibt? Man mag von Grönemeyer halten, was man will, aber wo er recht hat, hat er recht. Nicht ohne Grund gehören Geschichten wie die von Pippi Langstrumpf, von Michel aus Lönneberga oder der Roten Zora heute noch zu den beliebtesten Kinderbüchern. Auch die Verfilmung von Klaus Schädelins Lausbubenroman «Mein Name ist Eugen» lockte mehr als eine halbe Million Zuschauer in die Kinos. Dabei würde man nach heute gängigen Regeln all diesen «Saugofen» mindestens Ritalin verabreichen.
Ein bisschen mehr Chaos, bitte
Geht man davon aus, dass grundsätzlich eine stets grösser werdende Menge nicht mehr so gut unter Kontrolle gehalten werden kann, darf man annehmen, dass das ebenso für eine wachsende Kinderschar gilt. Und die Hoffnung sei deshalb erlaubt, dass die Kinder, mit allem, was zu ihnen gehört, wieder verstärkt in unsere Welt eindringen, sich da und dort wieder Freiheiten herausnehmen und Raum einnehmen und ein bisschen Chaos veranstalten.
Weshalb denn, was haben wir davon? Die Erklärung eines dreifachen Vaters für seinen Kinderwunsch ist wohl nicht die schlechteste: «Ich finde Kinder einfach wunderbar (…), unglaublich herzig, aufregend, herausfordernd, manchmal auch nervig. Und so geben die Kinder einem so vieles, auch wenn sie einen immer wieder stressen und ärgern. Sie machen das Leben für mich interessanter, lustiger und noch lebenswerter.»
Artikelgeschichte
Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 29.03.13