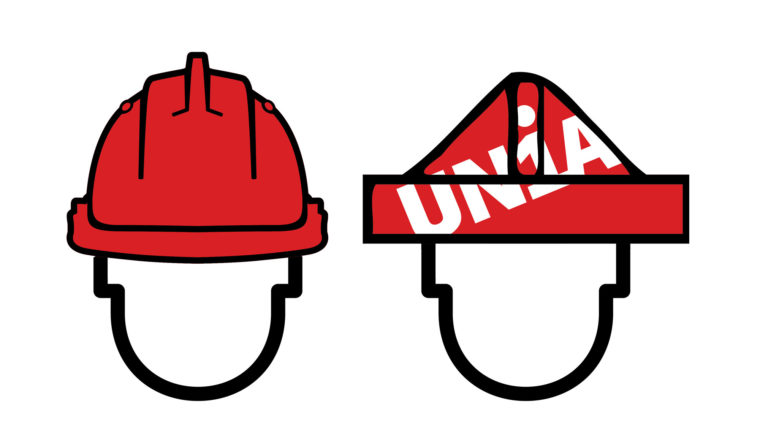Die grösste Schweizer Gewerkschaft Unia will um jeden Preis wachsen. Das bekommen die eigenen Angestellten zu spüren. Urs Müller, Präsident des Basler VPOD kritisiert die Methoden der Unia.
Es ist eine Aussage, wie sie von einem beliebigen, Abzocker-gesteuerten Konzern gemacht wird – sie stammt aber von der grössten Gewerkschaft der Schweiz, der Unia. «Die ehrgeizigen Wachstumsziele konnten nicht erreicht werden», beklagt die Unia in ihrem Tätigkeitsbericht 2008–2012. Sie strebte ein exponentielles Wachstum an, jedes Jahr im Schnitt doppelt so viele Neumitglieder wie im vorhergegangenen. 2012 hätten es 5000 sein sollen.
Misst sich ein Unternehmen an der Entwicklung des Aktienkurses oder Reingewinns, ist der Gradmesser von Erfolg und Misserfolg bei der Unia und ihren Mitarbeitern, wie viele neue Mitglieder sie anwerben konnten. Der Druck geht vom Kongress und Vorstand aus, die eine aggressive Wachstumsstrategie verfolgen, und wird an die Regionen, Teamleiter und schliesslich einzelne Mitarbeiter weitergegeben. Intern führt diese Ausrichtung zu Spannungen.
Ehemalige Mitarbeiter kritisieren Unia
Zwei ehemalige Mitarbeiter aus unterschiedlichen Sektionen beklagen die Arbeitsbedingungen bei der Unia. Sie hätten enorm unter Druck gestanden. Der Teamleiter habe ihn stark gedrängt, neue Mitglieder zu beschaffen, sagt der eine. Gegen Ende des Jahres, als sich abzeichnete, dass das verlangte Ziel nicht erfüllt werden kann, sei die Stimmung nicht mehr auszuhalten gewesen. Der Teamleiter sei autoritär aufgetreten, habe ihm mit der Entlassung gedroht, wenn er die Ziele verfehle.
Beim zweiten früheren Unia-Sekretär war es Enttäuschung, die ihn veranlasste zu kündigen. Er sei aus idealistischen Gründen zur Unia gegangen, weil er sich für die Rechte der Arbeiter einsetzen wollte. Doch dann habe er fast nichts mehr anderes gemacht, als Mitglieder anzuwerben. «Ich kam mir vor wie ein Verkäufer von Handy-Abos.» Mit gewerkschaftlicher Arbeit habe das nichts zu tun gehabt.
Im Extremfall droht Kündigung
Die Angestellten werden mit persönlichen Zielvereinbarungen verpflichtet, neue Mitglieder anzuwerben. In der Sektion Nordwestschweiz muss ein Gewerkschaftssekretär im Schnitt 40 bis 50 Aufnahmen pro Jahr generieren, das geforderte Maximum liegt bei 200 Zugängen pro Jahr. Verpasst ein Unia-Sekretär das Ziel, kann ihm der Lohn eingefroren werden. Im Wiederholungsfall drohen Verwarnungen, im Extremfall sogar die Kündigung.
In Basel sei das noch nicht vorgekommen, sagt Hans-Ulrich Scheidegger, Co-Leiter der Sektion Nordwestschweiz. Er sieht in den Beschwerden die Probleme Einzelner: «Es gibt immer Angestellte, die über zu viel Druck klagen, die meisten wissen die sehr guten Arbeitsbedingungen bei uns zu schätzen.» Scheidegger verteidigt die Wachstumsstrategie der Unia: «Unser Geschäftsmodell basiert darauf, dass wir genügend Mitglieder haben.» Das erlaube der Gewerkschaft, in Verhandlungen Druck ausüben zu können und sichere gleichzeitig deren Zukunft. «Die Leute, die wir anstellen, wissen, dass es zu ihrem Job gehört, Mitglieder anzuwerben.»
Problematischer Druck
Die Gewerkschaft der Staatsangestellten, der VPOD, distanziert sich von diesem Vorgehen. Urs Müller, Präsident der Basler Sektion, sagt: «Ich würde nie die Zahl der Neuwerbungen als Massstab nehmen, um die Leistung eines Angestellten zu beurteilen.» Der Druck, der so entstünde, sei problematisch, sagt BastA!-Grossrat Müller.
Die mühsame Arbeit wird zudem bescheiden entlöhnt. Ein Gewerkschaftssekretär hat bei der Unia einen Einstiegslohn von 5300 bis 5600 Franken – selbst wenn er einen akademischen Abschluss vorweisen kann. Beim VPOD liege dieser «bei über 6000 Franken», sagt Urs Müller.
Scheidegger hält den Lohn für angemessen. Ein Maurer mit eidgenössischem Lehrabschluss – typische Unia-Klientel – verdiene auch nicht mehr. Der Lohn bei der Unia orientiere sich an der Berufserfahrung, nicht an der Ausbildung.
Die Unzufriedenheit, die sich im Kanton Bern vor zwei Jahren sogar in einem Streik von Unia-Mitarbeitern äusserte, macht sich in der Zahl der Abgänge bemerkbar, die überdurchschnittlich hoch ist. In Firmen liegt die Fluktuationsrate bei unter zehn Prozent, in öffentlichen Verwaltungen – am ehesten mit einer Gewerkschaft vergleichbar – beträgt sie im Durchschnitt 5,9 Prozent pro Jahr. Bei der Unia ist sie laut eigenen Angaben knapp doppelt so hoch. Von den rund 900 Angestellten im Gewerkschaftskonzern suchen sich jedes Jahr 100 einen neuen Arbeitgeber.
Umstrittene Mindestlöhne
Das forcierte Wachstum bindet auch die Ressourcen. Diese fehlen dann, ist aus der Unia zu hören, bei den Kernaufgaben der Gewerkschaft, etwa dem Aushandeln von Gesamtarbeitsverträgen. Als Beispiel dient der GAV für die Reinigungsbranche. Da hat sich die Unia mit einem Minimallohn von 19.25 Franken pro Stunde einverstanden erklärt – was deutlich unter dem liegt, was die eigene Mindestlohninitiative fordert.
Die Unia argumentiert, ohne GAV wären die Löhne noch tiefer. Für die SP-Grossrätin Sarah Wyss, die drei Jahre als Vorarbeiterin in einem Putzbetrieb gearbeitet hat, ist der GAV nicht akzeptabel. Er ermuntere Firmen, ihr Putzpersonal auszulagern, an Firmen, wo sie zu schlechteren – aber von der Unia abgesegneten – Konditionen angestellt werden. Wyss sagt: «Ein GAV mit einem solch niedrigen Lohn kann verheerend sein.»
Artikelgeschichte
Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 12.04.13