Oh, Hochhaus – du Ausgeburt an Zweckmässigkeit, vom Zeitgeist verteufelt und gepriesen. Dabei bleibt das Hochhaus auch heute, was es früher war: Eine einfache Lösung für die Knappheit an Raum.
Das Erste war das Turmhaus am Aeschenplatz. Im Jahr 1928, als die Stadt noch spärlicher besiedelt war, ragte das erste Betonhochhaus der Stadt stolz in die Luft. Gut, es war ein bescheidenes Hochhaus: Gerade mal 31 Meter hoch, also weniger als die Hälfte der Münstertürme. Doch vor 87 Jahren war das eine eindrückliche Sache. Die Architekten Ernst Benedikt und Paul Vischer erstellten das Gebäude für die Vorläuferin der heutigen Baloise-Versicherung.
Danach blieb es lange ruhig: Die noch höheren Lagen der Basler Stadtluft blieben von Bauten unberührt. Bis Anfang der 1950er-Jahre ein Schrei der Empörung durch die Stadt ging: Da erdreistete sich eine Wohngenossenschaft tatsächlich, die ersten städtischen Wohnhochhäuser zu erbauen. Entenweid nannte sich die Siedlung an der heutigen Flughafenstrasse beim Kannenfeldplatz und sorgte für einen politischen, architektonischen und vor allem gesellschaftlichen Schock.
Der grosse Zoff um die Entenweid
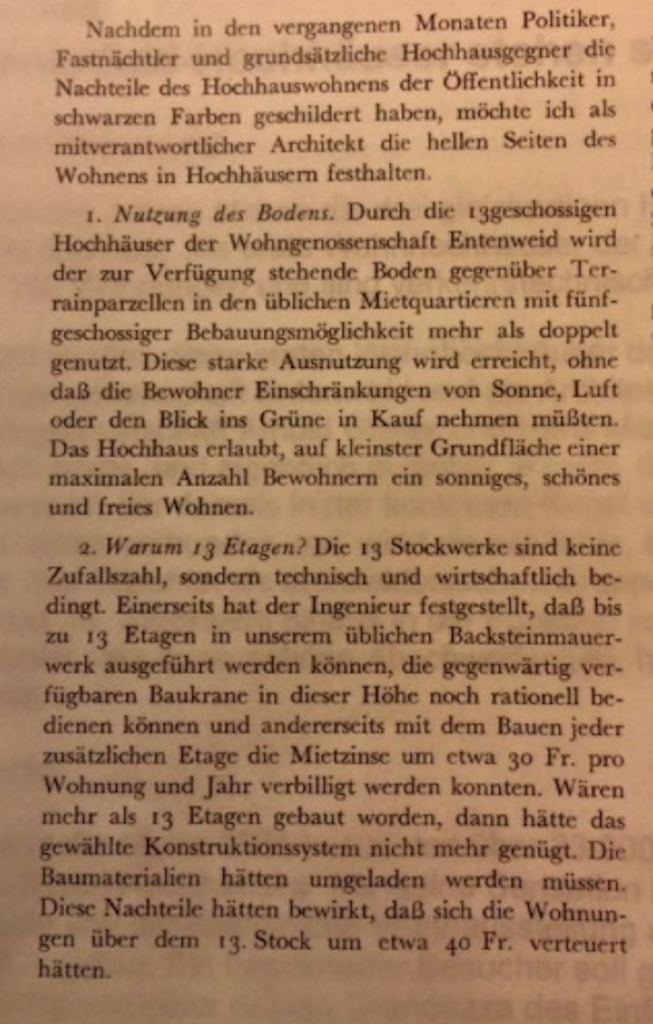
Auszug aus der Zeitschrift «Wohnen» 1951, in dem die Architekten den Bau der Entenweid-Siedlung rechtfertigen. (Bild: Auszug aus «Wohnen», Bd. 26, 1951)
Aus der damaligen Debatte strömt Zeitgeist allenthalben. Von Wohnmaschinen war die Rede, von Mietskasernen, und Hans Bernoulli schrieb 1951 in der Zeitschrift «Wohnen» im Brustton der Empörung: «Ein Turm ist kein Heim; er ist das Zinshaus, auf die Spitze getrieben; seine Existenzberechtigung ist das Kalkül.» Pikant: Hans Mähly, der mit Arnold Gfeller die Siedlung baute, arbeitete zuvor in Bernoullis Büro.
Damit markierte der konservative Basler Architekt die eine Seite des Diskurses über den Hochhausbau. Die andere Seite war durchaus angetan davon: So würden Grünflächen erhalten, die Wohnungen seien mit ihrer Aussicht und der luftigen Höhe von besonderem Wert.
Geprägt waren die Debatten vor allem von einer starken Wertungen und der Angst vor dem Neuen; Ästhetik war sekundär. Wie bitte soll denn die Mutter von oben herab zu ihren Kindern schauen, wenn diese sich weit ausserhalb ihrer Rufweite befänden?
Dennoch waren die zweckmässigen Lösungen von klassischen Problemen stichhaltiger: Basel litt an Wohnungsnot; die drei zwölfgeschossigen, 39 Meter hohen Wohnblöcke boten einen willkommenen Zuwachs an Wohnraum. 50 Jahre später war in der «Basler Zeitung» eine schwärmerische Hymne zu lesen, in der Kunstkritiker Sigmar Gassert von einem sachlich-zweckschönen Gebäude schreibt, von einer Baulegende gar, die noch heute – je länger, je mehr! – überzeugend sei.
Und die Schweiz reckte sich ein bisschen nach oben
Der Hochhausboom setzte trotz des Wehklagens Bernoullis ein: In den 1950er- und 1960er-Jahren sprossen die Hochhäuser in Basel förmlich aus dem Boden. Zum einen waren es Wohnhochhäuser – wie das im Hechtliacker auf dem Bruderholz –, zum anderen waren es Industriebauten und Geschäftshäuser wie die auf den Arealen der Firma Roche und der heutigen Novartis. Knapp die Hälfte der heutigen Basler Hochhäuser entstand in jener Zeit.
Max Frisch, Schweizer Autor und Architekt, soll im Nachkriegszürich gesagt haben: «Wie viel Himmel es noch gäbe auch über der Schweiz, wenn wir uns nicht ducken würden.» Ja, im Bauboom der wunderbaren Wirtschaftsjahre reckte sich die Schweiz tatsächlich ein bisschen nach oben. Zumindest die städtische.
Das erste Ende aber kam jäh. Die Ölkrise zu Beginn der 1970er-Jahre schüttelte die Wirtschaft durch. Umweltanliegen begannen den öffentlichen Diskurs zu beherrschen. Das standardisierte Wohnhochhaus – die scheinbare Ideallösung für das Bevölkerungswachstum – geriet unter gesellschaftlichen Druck: Zu stark wurden Arbeit und Wohnen getrennt, es bildeten sich Monostrukturen und die Hochhaussiedlungen generierten viel Verkehr.
Bernoullis harsche Worte anlässlich der Entenweid-Siedlung widerspiegelten nun die allgemeine Sicht aufs Hochhaus: Mietskasernen, das «Spiel mit Heimstätten für Menschen».
Das Hochhaus als «Kaninchenstall»
Das Resultat: Einschränkende Gesetzgebung und eine neue Wahrnehmung des Hochhauses als Lebens- und Arbeitsraum. Der Wolkenkratzer geriet ausser Mode, wurde altbacken, ein Unding. Die «Kaninchenställe» – wie es in einer Sendung des Schweizer Fernsehens 1971 aus dem Berner Quartier Gäbelbach hiess – waren nicht mehr chic, sondern nurmehr menschenunwürdige Bunker.
Ein Jahrzehnt später kamen die Hochhäuser zurück. Wieder war es die Wohnungsnot, die in den 1980ern den Bau von Wohnhochhäusern zaghaft förderte: Der Stadtstaat musst erfinderisch werden, wenn er der Abwanderung begegnen wollte. Der Aufschwung der Wohnhochhäuser begann wieder; jetzt war es aber nicht mehr der Systembau, sondern die massgeschneiderte Lösung, die auf Anklang stiess. Statt Standard-Mietskasernen also ansprechende Überbauungen, die die Mieter mit attraktiven Zusatzangeboten locken.
Blick vom Roche Bau 1 Richtung Messeplatz. (Bild: GEORGIOS KEFALAS)
Den endgültigen Anschub für das Streben in die Höhe gab schliesslich die Messe Basel. Mit ihrem 105 Meter hohen Messeturm – fertiggestellt 2003 – setzte sie ein klares städtebauliches Zeichen, dem weitere folgen sollten: Es kamen der St.-Jakob-Turm (2008) hinzu, das Markthalle-Hochhaus (2012), und seither folgt ein Projekt aufs andere: Die Roche mit ihren Türmen Bau 1 (178 Meter, im Rohbau) und Bau 2 (205 Meter, geplant), die Novartis mit ihren Neubau-Projekten auf dem Campus, das Meret-Oppenheim-Hochhaus, der Grosspeter-Tower und der Claraturm.
Das Meret-Oppenheim-Hochhaus, das auf der Südseite des Bahnhofs im Gundeldinger-Quartier stehen soll. 2019 soll das Gebäude fertig sein. (Bild: www.sbb.ch)
Prestige und Zweckmässigkeit
Der Hochhausbau hat Basel wieder im Griff. Nicht nur als städtebauliche Zweckmässigkeit, um mittels verdichteten Bauens der Wohnungsnot zu begegnen oder Arbeitsplätze zu konzentrieren. Sondern auch zu Prestigezwecken: Schliesslich begeben sich die Unternehmen wie Roche und Novartis damit unverrückbar in Sichtweite oder besser Sichtnähe der Öffentlichkeit.
Und auch die Baloise-Versicherung macht mit. Jene Gesellschaft, die mit dem Turmhaus 1928 das erste Basler Betonhochhaus errichten liess, baut heute am Bahnhof den Baloise-Park, dessen höchster Turm mit 90 Metern zwar nicht der höchste der Stadt ist, aber die unmittelbare Nachbarschaft – gemeint ist das sich in die Höhe schraubende BIZ-Gebäude – um immerhin 20 Meter überragt.
Vielleicht reckt sich nicht die ganze Schweiz in den Himmel, den Max Frisch vor knapp 70 Jahren beschrieb. Basel-Stadt zumindest aber duckt sich nicht; wie denn auch, wenn mit dem Roche Bau 1 bereits heute das höchste Gebäude der Schweiz am Rheinknie steht?
Aber noch immer erheben sich die Stimmen von akademischen Koryphäen ebenso wie von engagierten Laien, die jeden Hochhausbau als Grössen- beziehungsweise Höhenwahn oder gar als Pakt mit dem Kapitalismusteufel anprangern, der Basel seiner Seele beraube. Worte, die an jene erinnern, mit denen bereits Hans Bernoulli und Konsorten in den 1950er-Jahren gegen die Entenweid-Hochhäuser ins Felde zogen.
Die alte Version des Roche Bau 1: Das Projekt wurde redimensioniert. (Bild: Roche / Herzog de Meuron)
Noch ist der Rocheturm nicht fertiggestellt, schon kündigt das Pharmaunternehmen an, ein noch höheres Gebäude bauen zu wollen. (Bild: Herzog & de Meuron)
_
Weitere Quellen finden Sie auf der Rückseite dieses Artikels.
Quellen
- «Die Basler Hochhäuser vor ihrer Vollendung», Zeitschrift Wohnen, Band 26, 1950
- «Kannenfeld-Hochhäuser stehen seit 50 Jahren», Basler Zeitung vom 18.5.2001, Seite 32
- «Hoch und höher hinaus», Zeitschrift Hochparterre, Ausgabe 9, 2008
- Hochhauskonzept Basel-Stadt, Bau- und Verkersdepartement Basel-Stadt, 2010
- «Gelocht, geschüttelt, gebändert», Zeitschrift Hochparterre, Ausgabe 10, 2014




