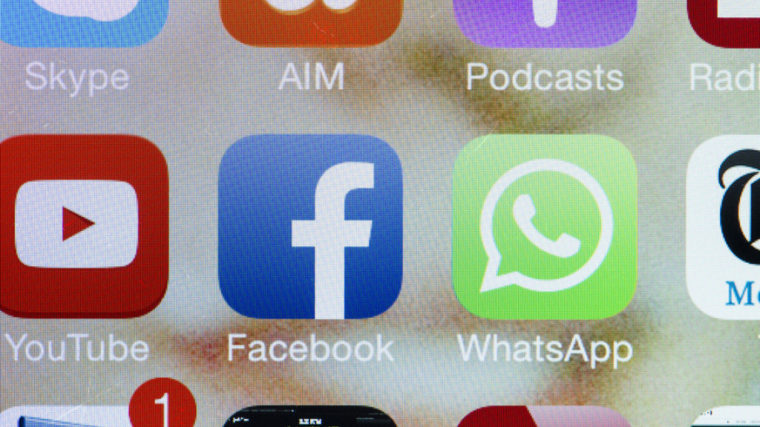Ganz umsonst gibt es selten etwas. Das gilt auch für Apps: Ein Studie stellt eine Wechselbeziehung zwischen Preisen und Privatsphäre fest. Je günstiger eine mobile Applikation, desto eher fordert sie Zugriffsrechte auf persönliche Daten.
Wer beim Download einer App gefragt wird, ob er Zugriffsrechte wie «den Aufenthaltsort der Nutzer zu erfassen» oder «Daten über das Internet zu versenden» erlauben will, sollte sich eine Zustimmung vielleicht noch einmal überlegen. Denn diese Rechte sind aus Sicht einer Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) als datenschutzrechtlich problematisch einzustufen.
Mit der Studie haben die Autoren untersucht, in welchem Ausmass mobile Applikationen dazu in der Lage sind, in die Privatsphäre von Nutzern und Nutzerinnen einzudringen und Informationen über deren Verhalten zu sammeln. Die Untersuchung kommt zum Schluss, dass jede zweite Gratis-App Zugriff auf sensible Informationen hat.
Knapp über 50 Prozent der kostenfreien Apps verlangten die als problematisch eingestuften Berechtigungen, heisst es in der am Dienstag veröffentlichten Studie. Bei den kostenpflichtige Apps liege dieser Anteil hingegen lediglich bei 20 Prozent.
Für die Anbieter der günstigen und kostenfreien Apps geht die Rechnung dennoch auf: Die Möglichkeit, auf persönliche Informationen der User zugreifen zu können, hat für die Anbieter einen Wert. Ihren Gewinn machen sie mit dem Verkauf von Produkten und Diensten durch die App oder alternativ mit personalisierter Werbung sowie dem Handel mit den gesammelten Daten.
Aufenthaltsort und Adressbuch
Insgesamt identifizierten die Autoren 136 verschiedene Rechte, von denen sie 14 als problematisch für den Schutz der Privatsphäre einstufen. Darunter fällt beispielsweise auch das Recht «das Smartphone mit einer eindeutigen ID zu identifizieren». Rund 40 Prozent aller Apps nähmen mindestens eines dieser problematischen Rechte in Anspruch, lautet das Fazit.
28 Prozent der Apps hätten dabei die Möglichkeit, App-User eindeutig über deren ID zu identifizieren. Ausserdem verfügten App-Anbieter bei 24 Prozent aller Apps über die Möglichkeit, den Ort der Nutzer und Nutzerinnen zu erfassen. Weitere acht Prozent der Apps können auf das Adressbuch der User zugreifen.
Vertrauen in den «guten Ruf»
Zwar lassen die Hinweise auf die geforderten Zugriffsrechte die User bei einem Download-Entscheid nicht völlig kalt. Apps, die kritische Berechtigungen verlangen, werden laut der Studie weniger häufig installiert.
Allerdings falle dieser Effekt eher gering aus und verschwinde nahezu komplett, wenn App-Anbieter bereits über eine gewisse Bekanntheit verfügten. Die Autoren beobachten hier einen «Reputationseffekt», der die User dazu veranlasse, bereitwilliger sensible Informationen zu teilen.
Für die Untersuchung wurden die verfügbaren Apps des Google Play Store im Jahr 2012 untersucht.