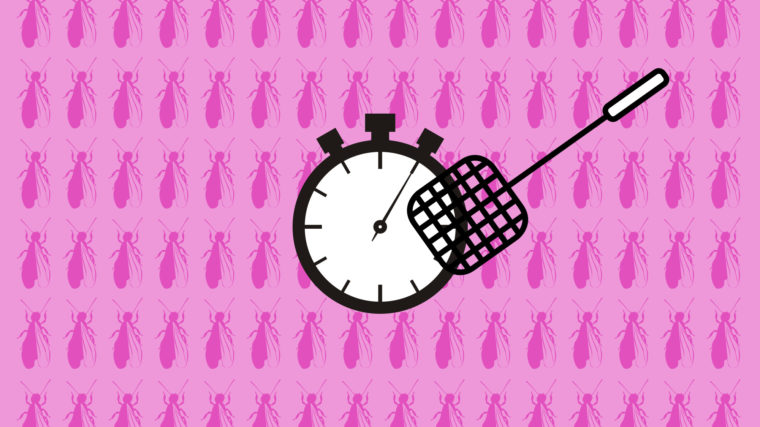Wieso klagen wir über Zeitmangel und fliehen doch vor jedem Innehalten? Community-Mitglied Marcus Tschudin über den unsinnigen Umgang mit einem kostbaren Gut.
Es gibt ein Unwort, das mich schaudern lässt, wann immer es mir zu Ohren kommt: Zeitvertreib. «Wir haben uns die Zeit mit Jassen vertrieben», höre ich da, oder «Das Fernsehprogramm war zwar schlecht, aber wenigstens diente es dem Zeitvertreib», oder «Mir ist langweilig, womit können wir uns die Zeit vertreiben?»
Ich habe diesen fahrlässigen Umgang mit dem kostbaren Gut Zeit nie verstanden. Warum um Himmelswillen müssen die Jahre, die uns auf Erden gegönnt sind, mit allen Mitteln verscheucht werden wie lästige Insekten? Weshalb diese Geringschätzung von Stunden, Minuten und Sekunden, in denen scheinbar «nichts läuft»?
Woher kommt das panische Gefühl, die erbarmungslos verrinnende Zeit verrinne zu langsam?
Wieso diese atemlose Flucht vor jedem Innehalten, diese zwanghafte Überzeugung, das alltägliche Leben sei per se langweilig und müsse ständig mit Kicks gewürzt werden? Woher diese Unfähigkeit, Nichtstun und Ereignislosigkeit auszuhalten; dieses panische Gefühl, die erbarmungslos verrinnende Zeit verrinne zu langsam?
Alle klagen über chronischen Zeitmangel und jammern, die Zeit vergehe zu schnell? Wäre es da nicht klüger, sich jedem Augenblick erst einmal auszusetzen, ihn vielleicht gar zu geniessen, statt zu glauben, ihn gleich vertreiben zu müssen? In seinem Roman «Austerlitz» schildert der deutsche Melancholiker Winfried Georg Sebald (1944–2001) eine Szene im Zentralbahnhof von Antwerpen, die mir jedes Mal unter die Haut geht:
«Tatsächlich befand sich an der Wand (…) als Hauptstück des Buffetsaals eine mächtige Uhr, an deren einst vergoldetem, jetzt aber von Eisenbahnruss und Tabaksqualm eingeschwärztem Zifferblatt der zirka sechs Fuss messende Zeiger in seiner Runde ging. Während der beim Reden eintretenden Pausen merkten wir beide, wie unendlich lang es dauerte, bis wieder eine Minute verstrichen war, und wie schrecklich uns jedesmal, trotzdem wir es doch erwarteten, das Vorrücken dieses, einem Richtschwert gleichenden Zeigers schien, wenn er das nächste Sechzigstel einer Stunde von der Zukunft abtrennte mit einem derart bedrohlichen Nachzittern, dass einem beinahe das Herz aussetzte dabei.»
Diese eindringliche Passage verstärkt mein Unbehagen, das ich angesichts des Unworts Zeitvertreib empfinde. Ich will die Zeit nicht vertreiben; ich wünsche mir, sie auszukosten. Gleichzeitig bin ich nicht darauf aus, jeden Anflug von Langeweile reflexartig mit Kurzweiligem zu bekämpfen, denn die mit ihr verbundene Dehnung der Zeit erzeugt in mir nicht selten eine abgeklärte Gelassenheit und ermutigt mich gleichzeitig, bewusster zu leben, intensiver zu erleben.
Die Zeit vertreiben? Nichts liegt mir ferner. Sie wird mich noch früh genug vertreiben. Jeder Zeitvertreib schubst mich nur rascher in Richtung des Unvermeidlichen, das unvertreibbar näher rückt.