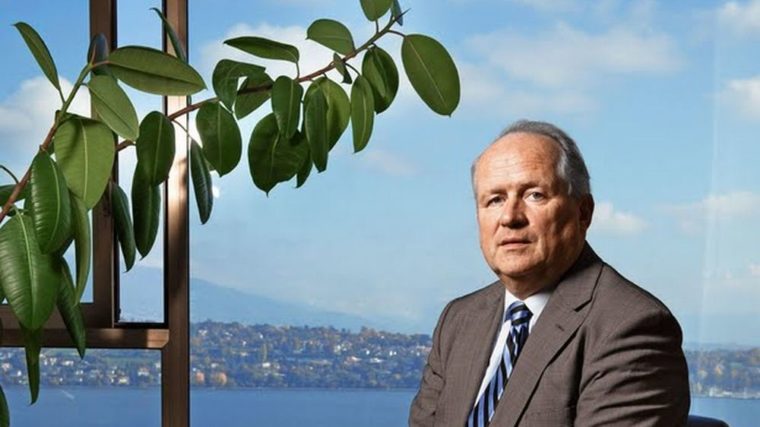Die Zukunft unseres Wirtschaftssystems sieht düster aus. Falls das Denken der europäischen Politiker nicht rasch und grundlegend ändere, werde der Euro zwangsläufig explodieren. Sagt Heiner Flassbeck, Chefökonom der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung.
Jeder Tag ist ein Demonstrations-Tag vor dem Palais des Nations in Genf. Koptische Christen aus Ägypten schreien an diesem Freitag im Oktober gegen die Brandstiftung ihrer Kirchen an, griechische Exilanten gegen den Ausverkauf ihrer Heimat. Es ist ein bekanntes Bild, die Akteure sind austauschbar. In New York, in Zürich, in Athen – die Menschen haben genug. Vom System. Von allem.
Heiner Flassbeck kann es ihnen nicht verübeln. Der ehemalige Staatssekretär des deutschen Finanzministers Oskar Lafontaine und heutige Chefökonom der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung sitzt in seinem farblich etwas speziellen Büro hoch über dem Genfersee und erzählt düstere Dinge über die Zukunft des Euros und die Zukunft von Europa. Flassbeck ist verständlich, mitreissend fast und – das macht den Inhalt seiner Sätze erträglich – voller Humor.
Herr Flassbeck, ist unsere Welt mit dem gegenwärtigen Wirtschaftssystem noch zu retten?
Wenn ich ganz ehrlich bin: nein.
Warum nicht?
Weil wir das System, in dem wir leben und wirtschaften, überhaupt nicht verstehen. Das liegt vor allem an den Ökonomen, die in den vergangenen 30, 40 Jahren ein Weltbild geschaffen haben, das mit der wirklichen Welt nichts, aber auch gar nichts zu tun hat.
Wie meinen Sie das genau?
Ein gutes Beispiel ist der amerikanische Makroökonom Thomas Sargent, der vor ein paar Wochen den Nobelpreis erhalten hat. Und wofür? Für ein Wirtschaftsmodell, das nur funktioniert, wenn die Menschen Mr. Sargents Modell der Wirtschaft kennen und sich entsprechend verhalten. Ein solcher Zirkelschluss ist einfach unwissenschaftlich. Aber solche «Kleinigkeiten» interessieren ja niemanden in der Ökonomie.
Gibt es auch ein paar ökonomische Grundsätze, die Sie nicht bestreiten? Das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage zum Beispiel?
Angebot und Nachfrage spielt schon – etwa in Basel auf dem Wochenmarkt. In vielen anderen Märkten funktioniert normale Preisfindung aber nicht mehr, weil Finanztransaktionen dominieren. Am deutlichsten zeigt das der Ölpreis, der nicht Angebot und Nachfrage, sondern sklavisch den Finanzmärkten folgt. Eine grandiose Illusion ist es auch zu glauben, dass der Arbeitsmarkt nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage funktioniert. In den USA ist die Arbeitslosigkeit hoch und deswegen steigen die Löhne nicht. Weil aber die Löhne nicht steigen, steigt die Konsumnachfrage nicht. Wenn der Konsum aber stagniert, kann die Arbeitslosigkeit nicht sinken. Beginnen die Löhne zu sinken, wird alles nur noch schlimmer.
Man hofft eben, dass die Zurückhaltung bei den Löhnen die Konkurrenzfähigkeit steigert, die Wirtschaft belebt und wieder für Vollbeschäftigung sorgt.
Das geht leider auch nicht, denn jemand verliert ja dann logischerweise an Wettbewerbsfähigkeit und kann die Güter, die wir ihm verkaufen wollen, nicht mehr bezahlen. Das ist das Problem der Eurozone. Der entscheidende Punkt, in dem ich mich von der herrschenden Meinung in der Ökonomie unterscheide, ist, dass ich sage: Der Arbeitsmarkt ist kein normaler Markt, er funktioniert nicht wie ein Kartoffelmarkt. Die Ökonomen ziehen mit der gegenteiligen Behauptung durchs Land und machen alle Politiker verrückt.
Sie fordern staatliche Eingriffe.
Die Konjunktur muss unbedingt wieder in Gang gebracht werden, mit Fiskalpolitik, etwas anderes gibt es derzeit nicht, da man sich an direkte Eingriffe in die Lohnbildung nicht herantraut. Bei stagnierenden Einkommen der privaten Haushalte sind aber extrem hohe neue Defizite nötig, damit die Konjunktur läuft, die Löhne endlich wieder steigen und die Arbeitslosigkeit gesenkt wird. Selber kann sich das Wirtschaftssystem nicht retten, obwohl das alle glauben.
Gelöst werden die strukturellen Probleme aber nicht, wenn der Staat die Wirtschaft ankurbelt.
Was nützt das Planen einer Wasserleitung, wenn das Haus brennt? Man muss über ganz neue Regeln nachdenken. Wie in Amerika, wo der Zins von der Zentralbank für zwei Jahre im voraus festgelegt worden ist. Bis vor Kurzem wäre das noch als Planwirtschaft bezeichnet worden. Entscheidend ist aber, dass die realen Löhne wieder strikt der Produktivität folgen.
In Europa ist das bis jetzt vor allem in Deutschland nicht der Fall.
Nein, dort gibt es ja auch niemanden, der die Zusammenhänge begreift. In der Schweiz gibt es immerhin einen – und der sitzt Ihnen gerade gegenüber (lacht lange).
Die Unternehmen verfolgen zwangsläufig ganz andere Ziele als Sie – sonst hätten sie es sehr schwer im globalen Wettbewerb.
Natürlich, die Unternehmer denken einzelwirtschaftlich. Das ist in Ordnung. Aber das ist auch der Grund, warum es den Staat braucht, der für die Gesamtwirtschaft sorgt, etwa über Eingriffe am Devisenmarkt. Das einzelwirtschaftliche Denken ist für die Gesamtheit falsch. Darum muss man die Unternehmer in ihren Vorstellungen auch immer wieder korrigieren.
Gelingt Ihnen das?
Manchmal schon. Einmal hatte ich sogar das Vergnügen, mit Herrn Blocher zu diskutieren. Den habe ich vollkommen irritiert, indem ich ihm immer wieder sagte: «Als Unternehmer haben Sie vollkommen recht, aber leider ist das für die Volkswirtschaft völlig irrelevant.» Nach der Diskussion war er so konsterniert, dass er am Abschlusspodium sagte: «Ja, ja, der Mann da hat schon recht mit ein paar Sachen.» So etwas hatte man von Blocher vorher wohl noch nie gehört.
Bei den wichtigen Entscheidungen verlassen sich die Politiker dann aber doch auf die traditionellen Ökonomen und nicht auf Sie.
Deswegen geht es ja auch so schief! In Deutschland hat die rotgrüne Regierung Ende der 90er-Jahre, als Finanzminister Lafontaine und ich weg waren, die Wirtschaftspolitik ihren Beamten überlassen, die noch aus dem alten Regime stammten und so vorgingen, wie sie das schon immer gemacht hatten. So entstand die berühmte «Agenda 2010».
Meinen Sie, dass mit Lafontaine alles besser geworden wäre?
Man kann von ihm halten, was man will. Tatsache ist, dass er einer der ganz wenigen Politiker ist, die sich mit einer Sache intensivst auseinandersetzen. Er würde nie einen Entscheid fällen, ohne einschätzen zu können, was wirklich passiert.
Die anderen Politiker – können oder wollen die das nicht?
Wer will, der kann. Jeder Politiker in der westlichen Hemisphäre kann sich die Welt von Stiglitz, Krugman und Flassbeck, um nur die «wichtigsten» zu nennen, erklären lassen. Die bekommt er alle an seinen Tisch, wenn er will. Dann müsste er nur noch ein paar Stunden gut zuhören, und schon könnte er sich ein Urteil bilden. Aber das tun die Politiker nicht. Warum nicht? Weil sie dann zuerst einmal zugeben müssten, dass sie nichts wissen.
Was müssten die Politiker denn wissen?
Zum Beispiel, dass der Wettbewerb unter Nationen nichts zu tun hat mit dem sinnvollen Wettbewerb unter den Unternehmen. Ein Standort, der einen anderen bekämpft, schadet dummerweise nicht nur einem Konkurrenten, sondern gleichzeitig einem Kunden. Das würde ein intelligenter Unternehmer niemals tun.
Ihre Vorstellungen bedingen Ausgleich und weltweite Solidarität. Ist das nicht etwas viel verlangt?
Für den nötigen Ausgleich braucht es ganz einfach Regeln. Wie in der WTO. Da gibt es zum Beispiel die schöne Regel, dass ein Land ein übermässiges Leistungsbilanzdefizit nicht hinnehmen muss. Diese Regel hätte man in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) anwenden sollen! Und schon wäre der Kern der Krise beseitigt gewesen! So aber hat Deutschland gewaltige Überschüsse und andere gewaltige Defizite, das kann nicht funktionieren. Ohne Ausgleich geht es nur im Wettbewerb unter den Firmen. Da kann der Stärkere den Schwächeren schlucken, was in vielen Fällen gut ist, weil der Stärkere in der Regel die besseren Ideen hat. Wenn aber Deutschland Frankreich vom Markt verdrängt, dann sind alle 60 Millionen Franzosen noch immer da. Und womit sollen sie sich nun die deutschen Güter kaufen, ohne Einkommen? Die Antwort ist einfach: Die Franzosen können nur noch mit dem Geld einkaufen, das ihnen Deutschland gibt. Das nennt sich Transferunion, so wie wir es in Deutschland mit den Ostdeutschen machen. Auf Europa können wir dieses Modell aber unmöglich übertragen. Das wäre politischer Sprengstoff par excellence.
Müsste in diesem Fall Europa eher Richtung politischer Einheit gehen, damit sich die Länder mehr um die Gesamtheit kümmern?
Mir geht es nicht so sehr um Einheit, ich bin gar nicht so einheitsverliebt. Es geht um Regeln. Und die gibt es in der Währungsunion: Die Inflationsrate soll zwei Prozent betragen. Das ist die zentrale Forderung. Schuldenstandards und so weiter sind nur Marginalien. Auf diese zwei Prozent haben wir uns vor zwei Jahren geeinigt. So, und jetzt macht Deutschland weniger als 1 Prozent Inflation, Griechenland 2,5, Spanien 2,6, Portugal 2,8. Wer hat nun gegen die Regeln verstossen?
Alle.
Eben. Aber wer ist schuld? Die «Griechen, die haben alles kaputt gemacht». Das ist schlicht falsch. Deutschland hat mehr gegen diese Regel verstossen als Griechenland. Schreiben Sie das in Ihrer Zeitung, das wird viele Menschen verärgern, aber es stimmt eben doch.
Ist es nicht typisch deutsch, sich selbst zu zerfleischen, obwohl man erfolgreicher ist als andere?
Insgesamt ist Deutschland ja gar nicht erfolgreich. Das Wachstum der ersten zehn Jahre in der EWU war geringer als in allen anderen Ländern. Deutschland hat bloss seine aussenwirtschaftliche Position auf Kosten der anderen gestärkt.
Sie können doch nicht bestreiten, dass in Ländern wie Griechenland oder Italien vieles schiefläuft.
Zu niedrige Arbeitszeiten, zu hohe Renten, schlechte Schulen und Korruption, das alles hat man jahrelang auch den Deutschen vorgeworfen, als sie das Schlusslicht beim Wachstum waren. Das ist immer so: Wenn es einem schlecht geht, fallen alle über einen her.
Sie sagen im Ernst: Griechenland funktioniert nicht schlechter als Deutschland?
Ich sage: Griechenland ist nicht schlecht. Das Staatsdefizit bedeutet noch lange nicht, dass das ganze Land eine einzige Katastrophe ist. Griechenland hatte 3 Prozent Produktivitätszuwachs im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, die Beschäftigung war gut, die Arbeitslosigkeit ging runter. Das heisst natürlich nicht, dass Griechenland nicht auch sehr viel Blödsinn gemacht hat. Aber das ist überall so. Auch wenn ich auf die Schweiz schaue, fällt mir da einiges ein.
Was denn?
Grundsätzlich gilt, dass die Schweiz die gleiche fatale Strategie einer einseitigen aussenwirtschaftlichen Orientierung fährt wie Deutschland. Die Schweiz hatte in den letzten zehn Jahren in der Spitze einen Leistungsbi-lanzüberschuss von 15 Prozent am Bruttosozialprodukt – das war der höchste der ganzen Welt! Statt an den heimischen Binnenmarkt zu denken, den es durchaus gibt, setzt auch die Schweiz auf ein Exportmodell. Das ist sehr problematisch, wie man an der Frankenentwicklung gesehen hat.
Wenigstens haben wir die Probleme mit dem Euro nur indirekt.
Für die Schweiz, das muss ich nicht erklären, ist die Position ausserhalb der Währungsunion dennoch schwierig. Der Euro hat ursprünglich kleinen Ländern wie Österreich sehr geholfen. Ich war auch ein Befürworter des Euro. Nachdem ich aber gesehen hatte, wie das mit der Einhaltung der Regeln läuft, wurde ich skeptisch. Schon 2004 sagte ich öffentlich, dass der Euro nicht stabil ist und früher oder später explodieren wird.
Und das wird nun geschehen?
Bleibt es bei der jetzigen Situation, hat der Euro leider keine Chance mehr. Ich sage leider, weil ich die Währungsunion für eine grosse Errungenschaft hielt. Aber solange sich Deutschland weigert, über das eigentliche Problem zu reden, das aussenwirtschaftliche Ungleichgewicht, solange hat der Euro keine Chance und wird uns um die Ohren fliegen. Statt über die wahren Probleme zu sprechen, fokussiert man sich auf die Schulden der Länder und zwingt sie, in der Rezession zu sparen, was niemals gut gehen kann. Alle Länder mit hohen Staatsschulden brauchen Wachstum. Wenn das Kernproblem nicht angegangen wird und die Unsicherheit weiter zunimmt, werden Finanzmärkte kollabieren, weil die Menschen ihr Geld ausser Landes schaffen. Müssten in letzter Konsequenz einige Länder aus der Währungsunion aussteigen, vielleicht hintereinander, vielleicht zusammen, wäre das eine Katastrophe, ein furchtbarer Prozess, aber in absoluter Verzweiflung machen Länder solche Dinge. Sie werden abwerten, ihre Grenzen dicht machen – Freihandel ist kein Naturgesetz –, und Deutschland verliert über Nacht seine so schön eroberten Märkte. Und dann, Gnade Gott Deutschland, dann wird es wirklich bitter. Ein Handelskrieg wäre die Folge, die Arbeitslosigkeit würde massiv steigen.
Sie rechnen ernsthaft mit diesem Szenario?
Rechnen kann man das nicht. Aber wenn das Grundproblem nicht gelöst wird, haben wir es die nächsten zehn, zwanzig Jahre mit Stagnation und Deflation zu tun. Das wird Europa politisch nicht aushalten.
Darum wurde der Rettungsschirm beschlossen.
Man darf nicht so tun, als ob mit einem Rettungsschirm das Problem aus der Welt wäre. Und man darf auch nicht so tun, als würde mit einer Angleichung der Wettbewerbspositionen alles sofort besser. Das wäre ein Prozess, der 10 bis 15 Jahre dauern würde, aber es wäre wenigstens eine Strategie. Ich bin übrigens nicht der Einzige, der das sagt. Leider kapieren es nur wenige. Die Euroländer halten stattdessen alle drei Wochen einen Krisengipfel ab, an dem sie sich manisch mit ihren Staatshaushalten beschäftigen, statt das Problem mit der Aussenwirtschaft zu besprechen.
Also wäre das System zu retten. Es würde einfach etwas dauern.
Ja, es ist zu schaffen. Die deutschen Politiker müssen begreifen, dass ihnen nur zwei Wahlmöglichkeiten bleiben. Entweder halten sie das jetzige System noch ein paar Jahre am Leben – bis es kracht. Oder sie ersetzen allmählich einen Teil des Exportmarktes durch den eigenen Binnenmarkt. Das ist ein Strukturwandel, der bei allmählich stärker steigenden Löhnen in Deutschland und Lohnzurückhaltung im Süden durchaus machbar ist.
Wenn das europäische System zusammenbrechen würde, käme nicht einfach ein neues?
Ein europäisches? In hundert Jahren vielleicht. Es ist so viel Schaden angerichtet worden, so unendlich viel Schaden durch die einseitigen Schuldzuweisungen. Mit der Griechenhetze in den deutschen Zeitungen wurde schon viel Porzellan zerschlagen, das sich so schnell nicht kitten lässt.
Stehen wir in einer ähnlichen Situation wie in den 1930er-Jahren, als die Wirtschaftskrise in einen Weltkrieg mündete?
Ich möchte mir das so nicht vorstellen. Vieles ist in der Tat ähnlich. Wenn man von Ländern wie Griechenland verlangt, dass sie in ihrer schlimmsten Krise ihr Staatsdefizit abbauen, ist das schlicht unmöglich. Das schafft kein Land der Welt! Wenn man Länder so an die Wand drängt, dann machen sie die verrücktesten Sachen. Man sieht ja heute schon, was in Griechenland los ist. Das wird noch schlimmer werden. Und es wird nicht mehr aufhören. Es ist ja keine Lösung in Sicht!
Herr Flassbeck, Sie machen uns Angst.
(lacht laut und lange). Ja, tut mir leid. Es ist nicht sehr gemütlich im Moment.
Wir haben uns lange mit der Politik beschäftigt. Liegt das Problem nicht auch beim Finanzwesen?
Das Problem besteht darin, dass die Politik nicht in der Lage ist, mit dem Finanzwesen adäquat umzugehen. Es wäre nämlich beherrschbar. Man könnte etwa das ganze Investmentbanking zurückschneiden und vom normalen Bankgeschäft strikt trennen. Die müssen nicht mit Rohstoffen spekulieren und auch nicht mit Währungen. Das muss man alles einschränken. Kein vernünftiger Mensch hat etwas gegen das Bankensystem, aber kein vernünftiger Mensch kann ein Zocker-Bankensystem wollen, in dem bei der UBS jeden Tag zehntausend Leute nichts anderes tun, als in irgendwelchen Casinos zu spielen.
Hätte die Schweiz die UBS bankrott gehen lassen müssen?
Das hätte man in der Situation nicht machen können. Der Fehler war überall, dass die Staaten die Banken gerettet haben, ohne sie sofort umzustrukturieren. Das ist nicht passiert. Und heute wundert man sich, dass wir wieder eine Bankenkrise haben.
Was sollen die Schweizer Politiker denn machen? Bei jedem Vorschlag heisst es, man wolle den Finanzplatz kaputt machen.
Tja. Dann lasst die Banken doch auf die Cayman-Inseln gehen – sollen die sie das nächste Mal retten! Die Schweiz muss sich fragen: Was bringen uns 10 000 Zocker-Banker volkswirtschaftlich? Gut, die konsumieren in der Schweiz, aber darauf müsste man halt verzichten. Das nützt der Schweiz ja nicht viel. Eine Bank, die vom Staat gerettet werden muss, hat einfach kein gesundes Geschäftsmodell. Gerade die Schweiz, die unbedingt solide sein möchte, fährt auf ein solches Zockersystem ab. Das verstehe ich nicht. Lasst sie doch gehen!
In Europa und Amerika gehen die Leute auf die Strasse und protestieren gegen das Finanzsystem. Haben Sie Verständnis dafür?
Absolut. Wenn mich die Leute an meinen Vorträgen fragen, was sie tun können, dann sage ich immer: Engagiert euch, und wenn es nicht anders geht, auch auf der Strasse! Die Politiker tun zu wenig, und die Ökonomen in ihrer ideologischen Gefangenschaft kann man nicht überzeugen. Die normalen Leute, jene, die sich vielleicht nicht so «sophisticated» äussern können wie ich, denen bleibt nur, ihren Unmut auf die Strasse zu tragen.
Würden Sie sich eigentlich als Linken bezeichnen?
War das links, was ich gesagt habe?
Es kommt bei den Linken gut an.
Das ist eine andere Frage! Das Motto meines Lebens ist: Bevor ich mich mit ideologischen Fragen beschäftige, beschäftige ich mich mit den logischen. Jetzt bin ich schon über 60 und bin immer noch nicht bei den ideologischen Fragen angekommen.
Sind Sie also ein unpolitischer Mensch?
Überhaupt nicht! Ich versuche nur, die Bereiche zu trennen. Das meiste, worüber wir geredet haben, hat nichts mit Ideologie zu tun, es gilt für links und rechts. Jeder vernünftige Mensch müsste das nachvollziehen können.
Quellen
Artikelgeschichte
Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 11/11/11