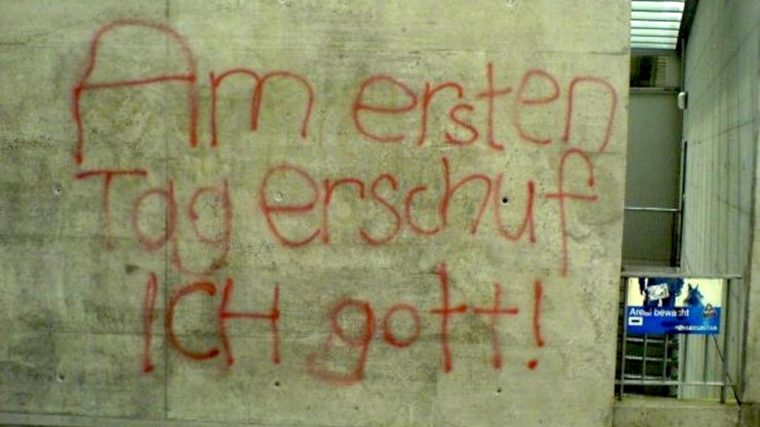Seit Monaten grassiert die mediale «Generation Y»-Epidemie: Mal sind wir erfolgsverwöhnte Faulenzer, dann wieder unsichere Schwachmaten oder partywütige Hedonisten. Nur eines sind wir selten: angemessen dargestellt. Eine letzte Empörung im alten Jahr.
2014 war das Jahr der «Generation Y». Zumindest wenn es nach den Medien ging. Kaum eine Woche, in der die wahlweise verwöhnte, faule oder unglückliche Generation nicht minutiös zerpflückt und in sauber vorgefertigte Schubladen gesteckt wurde. Zuvorderst an der Gen-Y-Front schrieb die «Zeit»: 45 Artikel-Treffer sind unter dem Schlagwort «Generation Y» im Jahr 2014 aufgelistet – das macht fast einen Artikel pro Woche. Mehr schaffte wahrscheinlich nur Ebola.

Die Artikel gehen alle in etwa dieselbe Richtung: Wir, die zwischen 1977 und 1998 Geborenen, sind angeblich eine Horde alleswollender und nichtskönnender Pseudo-Individualisten, die sich insgeheim nichts sehnlicher wünschen als verheiratet in einem Einfamilienhaus zwischen Designermöbeln und edlen Brotaufstrichen ein paar Kinder grosszuziehen.
Und das ist nur der Anfang. Laut Medien besetzen wir nämlich ein ganzes Kaleidoskop von Klischees:
1. Wir First-World-Nichtsnutze
Im Moment gibt es im Internet wohl nichts, was mehr «Generation Y» schreit als das Webmagazin «Vice». Anders als bei der zurückhaltenden Einheitspampe anderer Redaktionen, schreiben bei «Vice» Gen-Y-ler, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Auch wenn das semi-seriöse Artikel wie «Ich habe mir Kokain in den Arsch blasen lassen, damit ihr es nicht tun müsst» zur Folge hat.
In einem Kommentar zu seiner Generation schreibt «Vice»-Autor Clive Martin:
«Das ist meine Generation—die Generation, die keine wirkliche Motivation zum Erwachsenwerden hat. Wir haben keine Kinder, die in uns Schuldgefühle aufkommen lassen, und keine Hypothek, die wir abbezahlen müssen. Unser Gesundheitswesen ist gut genug, um uns am Leben zu halten, und wir verdienen in unseren Jobs genügend Geld, um uns zu ernähren, eine Bleibe zu finden und die Körperhygiene nicht zu vernachlässigen. Nur das Geschrei unserer Chefs und die besorgten Anrufe unserer Familien lenken uns kurzzeitig vom noblen Streben nach dem nächsten Alkoholrausch ab. Wir sind eine Armee von First-World-Nichtsnutzen, die in einem Escherschen Wasserfall der Unreife feststecken.»
Martin beschreibt die Y-ler als eine Generation trauriger Ewig-Jungen, die in einer Teenager-Endlosschlaufe feststecken und sich in regelkonformer Zügellosigkeit von einem Absturz zum anderen hangeln. Das ist natürlich überspitzt, ganz klar. Masslos übertrieben. Aber es ist unterhaltsam zu lesen und verfügt nicht über den debilen Jammerton der Gen-Y-Artikel. Tja, und das reicht uns Y-lern eben manchmal auch schon.
2. Wir kleinbürgerlichen Langweiler
Das «journalistische Experiment» des Schweiz-Bundes der «Zeit» hiess «Land ohne Jugend – Es ist okay» und ist eine hübsche Geschichte: Es erzählt von zwei Redaktoren, die die Idee haben, doch mal was über «diese Generation Y» zu schreiben. Glücklicherweise ist kurz vorher das Jugendbarometer der Credit Suisse veröffentlicht worden, in dem unter anderem steht, dass Junge vermehrt konservative Werte an den Tag legen.
Sehr gut, denken sich die beiden Redaktoren und suchen sich fix vier junge Vertreter (alle unter 20, knapp überhaupt noch «Generation Y»), die ihre weichgekochten Fragen mit druckfrischen Antworten vervollkommnen («Ich hätte sehr gerne die absolut idyllische Familie, wie man sie aus Filmen und Büchern kennt»). Fazit:
Vielleicht sitzt hier am Tisch im spießigen Aarauerhof tatsächlich die «Generation Bünzli», wie der Blick titelte. Eine Generation so gut ausgebildet, wie keine vor ihr. Eine Generation, die sich problemlos in die sich ständig verändernde Gegenwart einpassen kann. Die aber auch ahnt, dass die goldenen Zeiten vorbei sind, die ihre Eltern erlebten. Die nicht die Wohlstandsmehrung, sondern das Niveauhalten anstrebt. Alles soll bleiben, wie es ist.
Na dann, vielen Dank.
3. Wir glückssüchtigen Egoisten
Wenn es 2014 punkto «Generation Y» noch etwas Deprimierenderes gab als das vorher aufgeführte «Experiment», dann war es Aline Wanners Kommentar dazu. Die Basler Autorin stellte sich brav in die Reihe ihrer Vorgänger und zerstörte somit so ziemlich jedes bisschen Würde, das uns «Jungen» nach der «Land ohne Jugend»-Peinlichkeit noch blieb:
«Ja, meine Generation, die Ypsiloner, sie wünscht sich im Leben nur eins: ein ewig währendes Happy End. Mit Haus und Mann oder Frau und Kindern. Mit etwas Karriere, aber nicht zu viel. Gerade so, dass es für ein gutes Leben reicht, wie dieZEIT (Nr. 51/14) in ihrer letzten Titelgeschichte schilderte.»
Und wer hier noch nicht mit den Augen rollt, kann sich dann definitiv mit Wanners Fazit abschiessen:
«Und Leben besteht nun einmal aus mehr als einfach nur Glücklichwerden. Leben ist kein abstrakter Zustand. Leben bedeutet auch scheitern. Widersprechen. Kämpfen. Leiden. Egal, wann man geboren wurde. Das müssen wir nicht nur uns selbst, sondern auch unseren Eltern eingestehen. Jenen Eltern, die uns alles ermöglichten und die nichts als unser Glücklichsein erwarten.
Wir müssen also aufhören zu suchen. Wir müssen endlich aufhören, uns nur mit uns selbst zu beschäftigen. Denn das können selbst unsere Eltern, Lehrer und Professoren nicht gewollt haben, als sie uns nur Glück im Leben wünschten.»
Da lese ich auch lieber über Kokain im Hintern.
4. Wir verwöhnten Kinder der Neuzeit
Es gab sie auch: Die guten Kommentare (oder die guten Gen-Y-Ressorts, wie der «Guardian» eins hat). Einer davon war Milosz Matuscheks Gastkommentar in der NZZ, in dem der Schriftsteller differenziert über seine Generation sinnierte. Allerdings nicht, ohne auch die gängigen Klischees zu erwähnen: Wir posten Fotos von Ziegenkäsesalat, streiten über Lifestyle-Themen, sind gefallsüchtig und pseudo-hip. Schuld sei das «Anything goes», die Selbstauflösung der Autoritäten, mit der wir aufgezogen wurden.
«Was früher Weltverbesserung war, heisst heute Selbstoptimierung. Selbst wenn wir uns für irgendetwas einsetzen, unterschreiben wir meist nur eine Petition im Internet. Wir sind die passivsten Aktivisten, die es je gab. Die Gegenwartsverhaftung kulminiert in der Chiffre «#Yolo» («You only live once»).
Unsere Revolution ist der Siegeszug des «Chill mal». Doch diese Haltung ist letztlich parasitär. Wir profitieren vom Gegebenen und fügen nichts hinzu, ausser vielleicht einmal eine neue App.»
Auch wenn es mir schwer fällt, es zuzugeben: Ich glaube, Matuschek hat recht. Wir sind weder so cool, wie wir tun, noch haben wir gross Lust auf weltverändernde Aktionen. Hauptsache, uns geht es gut und unser Mikrouniversum stützt uns mit genügend Likes. Alles wahr, imfall.
Trotzdem: Was fehlt, ist Matuscheks Selbstironie. Denn mit der ist unsere Generation glücklicherweise massenweise gesegnet. Klar freue ich mich, wenn mein Profilbild auf Facebook 80-mal geliked wird. Klar habe ich keine richtige Leidenschaft für etwas, nur so ein paar halbrichtige und die meistens auch nur, um irgendwen zu beeindrucken. Klar klicke ich mich als Zeitvertrieb am liebsten durch die Instagram-Feeds von italienischen Fashion-Editors. Klar lese ich heimlich im Zug das «Friday»-Magazin. Klar ist das alles scheisse. Aber, wie eine gute Bekannte es letztlich ganz treffend formulierte: «Who the fuck cares?» Niemand. Dann können wir ja wohl noch so sein, wie wir wollen. Und uns darüber amüsieren.
Wenn mir schon die ganze Zeit vorgeflennt wird, dass ich meine Pensionskasse vergessen kann und die Welt am Arsch ist (was ist das für eine Schweiz, wo ein halbinteressanter Schlagabtausch zwischen zwei überschätzten Gockeln über Wochen in den Medien diskutiert wird? Wenn wir schon von «Land ohne Aufstand» reden), dann darf ich doch wohl machen, was ich will.
Why so interested?
Nach dieser Flut von Definitionsversuchen ist das einzige Y was meine Generation noch interessiert, das: Why so interested? Reichen die ganzen Lifestyle-Abhandlungen im Leben-Ressort nicht mehr? Wieso wird plötzlich alles, was momentan in der gesellschaftlichen Entwicklung der Industriestaaten «falsch» läuft, auf unsere Generation bezogen?
Schon klar, jede Generation braucht eine darauf folgende, um sich den Mund zu zerreden, darüber, was sie alles anders oder falsch macht. Und das ist ok. Es ist ok, sich eine Meinung machen zu wollen. Es ist nicht ok, sich mithilfe von weichgespülten Vorurteilen ein Erklärungsmodell der Welt zusammenzuschustern, nur um irgendwelchen Nicht-«Generation-Y»-Lesern ein verlogenes Aha-Erlebnis zu bescheren.
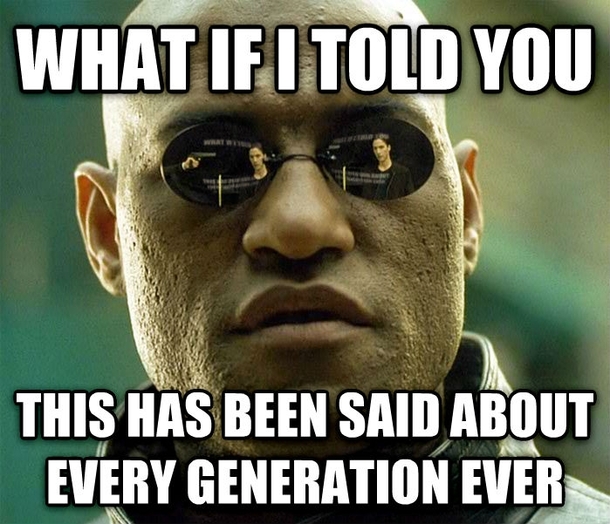
Die Wahrheit ist vielschichtig. Wer ist diese «Generation Y» schon? Sie mag teure Brotaufstriche, glatte Gadgets und schlaue Serien? Das mag mein Vater alles auch. Sie setzt sich für Teilzeitarbeit ein? Hat meine Mutter auch. Sie ist masslos überfordert und weiss nicht, wohin mit sich? Wer weiss heute schon, wohin mit sich? Was passiert, ist Zeitgeist, nicht «Generation Y».