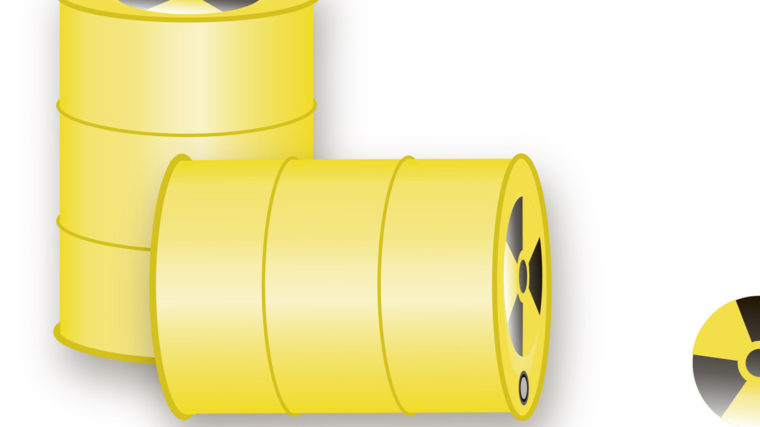In der Schweiz wird es keine neuen Atomkraftwerke mehr geben. Die bestehenden aber laufen weiter und produzieren ständig neuen Atommüll. Was damit geschehen soll, ist nach wie vor unklar.
Die Schweiz steigt aus der Atomkraft aus. Das hat der Nationalrat in seiner neuen Zusammensetzung letzte Woche bekräftigt. Damit hat er die Linie von Bundesrat und Ständerat klar gestützt. Jetzt kann der Bundesrat daran gehen, die Stromversorgung der Schweiz ohne neue AKW konkret anzugehen.
Die Probleme der Atomkraftnutzung sind damit allerdings nicht vom Tisch. Denn vorerst laufen die Reaktoren in Beznau, Mühleberg, Gösgen und Leibstadt weiter und bleiben als Gefahrenquelle erhalten. Und die Frage der Entsorgung des Tag für Tag neu produzierten Atommülls bleibt nach wie vor ungelöst.
Wo der zum Teil jahrtausendelang strahlende AKW-Abfall entsorgt werden soll, weiss man trotz gegenteiligen Beteuerungen der AKW-Betreiber und der Bundesbehörden bis heute nicht. Für die vermeintlich saubere Atomtechnologie gibt es bis heute weltweit keine wirklich nachhaltige, saubere Müllentsorgung. Während man von jedem privaten Hausbesitzer in der Schweiz den Anschluss an die Kanalisation verlangt, damit das Abwasser abgeführt werden kann, erlaubte man den Stromkonzernen in der Technikeuphorie der Gründerjahre Bau und Betrieb von Atomreaktoren ohne einen Plan für die dazugehörige Entsorgung. Seither stapelt sich der Atommüll nicht nur in der Schweiz auf immer grösseren Halden.
Als das Problem auch der breiten Öffentlichkeit bewusst wurde, beeilte sich die Schweizer Politik, zumindest gesetzgeberisch zu reagieren: Der Bau neuer und der Weiterbetrieb der fünf laufenden Reaktoren wurde 1978 an den Nachweis der sicheren Entsorgung gekoppelt. Den sollte die Nagra, die von den AKW-Betreibern getragene Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, bis Ende 1985 erbringen. Ohne diesen Nachweis müssten die AKW abgestellt werden, verlangte das Atomgesetz.
Eiertanz um Entsorgung
Was darauf folgte, war ein politischer Eiertanz: Angesichts der objektiven Schwierigkeiten, eine für Jahrtausende sichere Entsorgung des gefährlichen Atommülls zu garantieren, wurden die Anforderungen an den zu erbringenden Nachweis ständig reduziert. Statt einen fixfertigen Entsorgungsplan mit konkreten Anlagen vorlegen zu müssen, reichte es deshalb schliesslich, den Nachweis der technischen Machbarkeit zu erbringen. Nach jahrzehntelangem Seilziehen akzeptierte der Bundesrat 1988 zuerst den Nachweis für die weniger lang strahlenden schwach- bis mittelaktiven Atomabfälle, 2006 schliesslich auch den für den besonders gefährlichen hochradioaktiven AKW-Müll. Seither gilt die Entsorgung in der Schweiz als grundsätzlich machbar, die gesetzlichen Voraussetzungen für den Betrieb der AKW sind erfüllt.
Was aber nach wie vor fehlt, sind die Endlager, in denen man den Strahlenmüll langfristig von der Umwelt isolieren will. Am weitesten gediehen waren die Pläne der Nagra am Nidwaldner Wellenberg, dessen geologischer Untergrund der Nagra für ein Lager der schwach- und mittelaktiven Abfälle geeignet schien. Doch das Projekt im Engelbergertal scheiterte am Widerstand der Nidwaldner. Mehrmals sagten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Urne Nein dazu. Seither ist bei Nagra und Bundesbehörden die politische Akzeptanz das Hauptproblem für einen Endlagerbau und nicht die Geologie.
Standortkanton entmündigt
Um den Widerstand Direktbetroffener zu erschweren, strich das eidgenössische Parlament 2005 das kantonale Vetorecht gegen ein Atomlager auf eigenem Gebiet. Seither ist gegen ein Projekt nur noch ein nationales Referendum möglich: Statt des Standortkantons wird künftig die ganze Schweiz über ein Endlager abstimmen. Die Absicht ist klar: Die Bevölkerung nicht direkt betroffener Kantone stimmt einem Endlager irgendwo weit weg eher zu. Eine nationale Mehrheit ist viel einfacher zu gewinnen als eine kantonale.
Allerdings: Diese Art, Entscheide zu fällen, passt nicht zum urschweizerischen, basisdemokratischen Demokratieverständnis. Die gesetzgeberische Entmündigung eines Kantons schafft das Problem der politischen Akzeptanz nicht aus der Welt. Wie also bringt man eine Gemeinde, eine Region, einen Kanton dazu, ein Endlager zu akzeptieren? Beim zentralen Atommüll-Zwischenlager (Zwilag) in Würenlingen ist das gelungen: Entschädigungszahlungen an die Standort- und die unmittelbaren Nachbargemeinden haben im atomfreundlichen unteren Aaretal im Aargau dafür gesorgt, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich nicht an Atomanlagen in unmittelbarer Umgebung stört. Da andernorts diese Karte aber weniger gut stechen könnte, sucht man seither nach politisch weniger anrüchigen Methoden.
Nie mehr Wellenberg
Nach der Wellenberg-Erfahrung, wo in erster Linie die Nagra selbst agiert hatte, übernahmen jetzt die Bundesbehörden die Hauptverantwortung. Das Bundesamt für Energie (BFE) schuf den Sachplan geologische Tiefenlager, der im April 2008 vom Bundesrat abgesegnet wurde und seither das Standort-Auswahlverfahren regelt. Er sieht sechs mögliche Standortgebiete vor: das Bözberggebiet (Jura Ost), den Jura-Südfuss, das Gebiet nördlich der Lägern, den schaffhausischen Südranden, das Zürcher Weinland (Zürich Nordost) und nach wie vor den Wellenberg. In einem dreistufigen Auswahlverfahren sollen zwei auserkoren werden: ein Standort für ein Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle und eines für hochradioaktive Abfälle. Ob tatsächlich zwei getrennte oder nur ein gemeinsames Lager gebaut wird, bleibt bisher offen.
Vor Kurzem hat der Bundesrat den Bericht zur ersten Etappe gutgeheissen und den Start zur zweiten erteilt. In den nächsten vier Jahren sollen die sechs Standortgebiete sicherheitstechnisch vertieft untersucht und auf den gleichen Wissensstand gebracht werden. Wichtig wird das sogenannte Partizipationsverfahren: In den sechs Gebieten sollen Behörden, Bevölkerung und Interessengruppen in Zusammenarbeit mit der Nagra und dem federführenden Bundesamt für Energie in die Planung allfälliger Endlager einbezogen werden. Zu diesem Zweck wurden sechs neue Gremien ins Leben gerufen, sogenannte Regionalkonferenzen, in denen ausgewählte Vertreter unter der Leitung professioneller Mediatoren bei der konkreten Lagerplanung vor Ort mitreden sollen. Ausser am Wellenberg, wo sich Gemeinden und Bevölkerung weigern, bei der Übung mitzumachen, haben sich die Regionalkonferenzen inzwischen formiert. Mit an Bord sind auch erklärte Atomgegner.
Reine Alibiübungen
Was gut tönt, ist bei Licht betrachtet aber eine «Scheinmitsprache»: Zum Grundsatzentscheid, in einer Region ein Lager zu bauen, haben die Konferenzen nämlich nichts zu sagen. Das räumen auch die für das Verfahren zuständigen Bundesverantwortlichen ein, nur sagen sie das nicht laut. «Der frühe und umfassende Einbezug der Behörden, der Bevölkerung und Interessengruppen soll sicherstellen, dass das Verfahren transparent und fair abläuft», heisst es dazu im Bundesamt.
Von einer «reinen Alibiübung» spricht Sabine von Stockar von der atomkritischen Schweizerischen Energiestiftung, von einer «Psychotherapie für entmündigte Staatsbürger» Jean-Jacques Fasnacht, Arzt im zürcherischen Benken. Er ist Wortführer der Weinländer Oppositionsgruppe «Klar», aber auch Mitglied der 80-köpfigen Regionalkonferenz Zürich Nordost. So nennen die Kommunikatoren des Bundesamts das Zürcher Weinland neuerdings.
Kulturwandel schafft Vertrauen
Absehbar ist jetzt schon, dass alles noch so gut moderierte Debattieren über die Vor- und Nachteile eines Atommülllagers für eine Region den lokalen Widerstand nicht brechen wird. Am Wellenberg, im schaffhausischen Südranden und vor allem auch im Zürcher Weinland, das für ein Hochradioaktiv-Lager am besten geeignet sein soll, wird ein Endlagerbau politisch kaum durchzusetzen sein. Will man tatsächlich eine unpolitische, auf reinen Sicherheitskriterien beruhende Standortwahl, braucht es einen grundsätzlichen Kulturwandel der Akteure bei der Nagra, beim Bund und den AKW-Kantonen. Der Sachplan des Bundes mit seinem starren, in Verwaltungsstuben entwickelten Fahrplan, bringt dieses Umdenken nicht.
Der Genfer Geologieprofessor Walter Wildi, von 2002 bis 2007 Präsident der (zu) unabhängigen Kommission für die Sicherheit der Atomanlagen und Architekt des konsensorientierten aktuellen Lagerkonzepts, bringt das Problem auf den Punkt: «Die Nagra müsste von der heutigen Haltung, die Probleme auf dem bequemsten Weg zu lösen, umgestimmt werden zur Haltung, eine Lösung mit bestmöglicher Sicherheit zu suchen. In ähnlicher Weise muss die Sicherheitsbehörde des Bundes, das Ensi, ihre Aufgabe nicht mehr darin sehen, zu zeigen, dass die vorgeschlagene Lösung zur Atommüll-Lagerung sicher ist, sondern sie muss als Anwalt der Öffentlichkeit prüfen, ob die Sicherheit gegeben ist.»
Und schliesslich müssten die Kantone als Aktionäre der Elektrizitätsgesellschaften, welche die AKW betreiben, ihr Doppelspiel aufgeben: Heute lassen sie «ihre» Nagra vor sich hinwerkeln und wenn dann Lagerprojekte vorliegen, opponieren sie. Statt des Doppelspiels müssten sie die Nagra in die Verantwortung nehmen und reformieren. Nur so kann das öffentliche Vertrauen geschaffen werden, das Voraussetzung ist, um das Atomkraft-Zeitalter so schadlos wie möglich zu seinem eingeläuteten Ende zu bringen.
Artikelgeschichte
Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 16/12/11