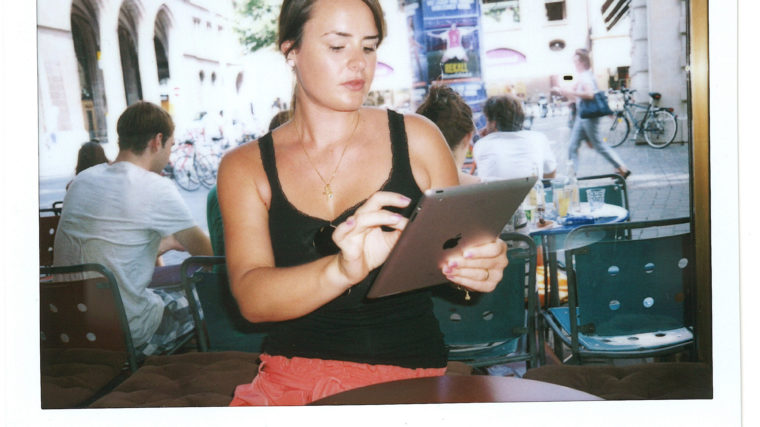Ist das Jammern über die «Generation gratis» berechtigt? Muss der Staat eingreifen? Die Debatte läuft schon länger – jetzt beginnt sie auch in der Schweiz.










Sie hatten etwa das gleiche Alter, stammten aber aus verschiedenen Welten. Sie standen an einem heissen Augusttag vor der altehrwürdigen Orangerie in Bern und redeten über das Internet. Links Roland Grossenbacher, der Leiter des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum, seit Jahrzehnten beim Bund, ein freundlicher und zuvorkommender Mensch, gewöhnt an die geregelten und etwas langsamen Abläufe der Bundesverwaltung. Rechts Peter Hossli, ein ebenso erfahrener Journalist, ein «neugieriger Reporter, der stets gute Geschichten sieht», wie es in seinem Lebenslauf heisst, immer mit der Nase im Wind.
Es war vor allem Hossli, der redete. Der Reporter erklärte dem Leiter des Instituts für Geistiges Eigentum, dass man heutzutage wenige Stunden nach der Ausstrahlung die neueste Folge jeder in Amerika ausgestrahlten Fernsehserie innert Minuten auf seinen Computer laden könne. Total legal, kostenlos und in bester HD-Qualität. «Tatsächlich?», fragte Grossenbacher und schien ehrlich erstaunt.
Die Leerkassetten
«Wissen Sie», sagt der langjährige Bundesangestellte ein paar Tage später am Telefon, «als wir 1992 das Urheberrecht revidierten, sprachen alle von Leerkassetten. Als das Gesetz fertig war, gab es keine Kassetten mehr.» Der Gesetzgebungsprozess könne niemals mit dem technologischen Fortschritt mithalten, «an das müssen wir beim Legiferieren immer denken».
Mit dieser guteidgenössisch unerschütterlichen Verwaltungsmentalität wird Grossenbacher nun auch eine der grössten Aufgaben seiner Bundeskarriere angehen. Er hat die Aufgabe von Bundesrätin Simonetta Sommaruga an jenem Tag in der Orangerie erhalten, an jenem Tag, an dem die Bundesrätin «das Megathema» Urheberrecht zu ihrem Thema machte. Eine Arbeitsgruppe wird im Oktober damit beginnen, über eine künftige, über eine moderne Ausgestaltung des Gesetzes nachzudenken. Grossenbacher wird diese Arbeitsgruppe leiten und ihm ist bewusst, was hier auf ihn zukommt. «Das Thema ist so virulent, weil sich eine ganze Generation, die Generation Internet, vom Urheberrecht angegriffen fühlt.»
Grossenbachers Aussage gilt in erster Linie für unser Nachbarland Deutschland, wo seit ein paar Jahren ein regelrechter Glaubenskrieg um das Urheberrecht ausgefochten wird. Künstler wie Sven Regener von der Band Element of Crime halten Brandreden auf die Mitglieder der «Generation kostenlos», die keinen Anstand und keinen Respekt hätten und den Künstlern «ins Gesicht pinkelten». «Absurd und oberflächlich», schallt es hämisch von der Piratenpartei zurück, jener Gruppierung, die wohl am ehesten die Lebensrealität der Internetgeneration vertritt und hartnäckig und lautstark dafür kämpft, dass diese Lebensrealität auch in den staatlichen Strukturen abgebildet wird.
Ein Glaubenskrieg
In der Schweiz ist die Diskussion um das Urheberrecht noch nicht derart emotionalisiert, was auch damit zu tun haben dürfte, dass die Piratenpartei in der Schweiz nicht so stark ist wie in Deutschland. Erste Anzeichen für den Glaubenskrieg gibt es aber auch hierzulande. Der im Februar neu gegründete Verein Musikschaffende Schweiz hat in einer seiner ersten Stellungnahmen die Schweiz als das «Guantánamo des Urheberrechts» bezeichnet, weil die Downloads urheberrechtlich geschützter Inhalte zum Eigengebrauch nach wie vor legal sind.
Man muss nicht lange nachdenken, um die Heftigkeit dieses Streits zu ergründen. Es geht, wie immer bei den grossen Debatten der Menschheit, um Geld. Sehr viel Geld sogar. Zwischen 1999 und 2007 haben sich die Musikverkäufe in der Schweiz nahezu halbiert, wie ein Bericht des Bundesrats zur «unerlaubten Werknutzung über das Internet» vom August 2011 festhält. Nachgezeichnet wird der Niedergang der Verkaufszahlen auch von der IFPI, dem Branchenverband der Schweizer Labels. 1995, im besten Jahr der jüngeren Geschichte, machten die Schweizer Tonträger-Produzenten einen Umsatz von 317 Millionen Franken. 2011 waren es noch 124 Millionen; davon 93 Millionen mit CDs und 31 Millionen mit digitalen Produkten.
Zwei Migros im Dorf
«Mit dem Aufkommen des Internets hat die Bereitschaft, für Inhalte zu bezahlen, abgenommen», sagt Martin Wüthrich von der Verwertungsgesellschaft Suisa. «Das ist, wie wenn es in einem Dorf zwei Mi-gros hat. Eine, wo man bezahlen muss. Und eine, wo es alles gratis gibt. Wo gehen die Leute hin?»
Für Wüthrich ist das nicht ein auf die Musikindus-trie beschränktes Problem – sondern eine der grossen philosophischen Fragen dieser Zeit. Und er ist nicht der Einzige mit dieser Haltung: Egal, mit wem man aus der Musikbranche redet. Egal, mit wem man aus der Film- oder der Medienbranche redet. Wer über viele Jahre mit bezahlten Inhalten Geld verdient hat, wacht plötzlich auf und stellt erschreckt ein grundsätzliches Problem fest. Eine «Gratismentalität», wie Wüthrich von der Suisa sagt. Eine ganze Generation von jungen und mittelalterlichen Menschen, die sich in den vergangenen zehn Jahren daran gewöhnt haben, dass sie viele Dinge in ihrem Leben nicht mehr bezahlen müssen. Die Pendlerzeitung am Morgen, die Pendlerzeitung am Nachmittag, die Nachrichtenportale im Internet, Musik, Filme, Games, ja Konzerte sogar. Tino Krattiger hört jedes Jahr, wie Besucher seiner Gratis-Konzertreihe «Im Fluss» sich über die prominent aufgestellte Bar enervieren, die den Blick auf die Bühne verstellt. Und dabei nicht begreifen, dass es diese Bar ist und die darin versammelte Sponsoren-Prominenz, die den kostenlosen Anlass überhaupt ermöglichen.
Das Ende unserer Kultur
Es ist die hohe Zeit der Kulturpessimisten, der Warner und Jammerer. Von Leuten wie dem britisch-amerikanischen Autor Andrew Keen etwa, der die Gratismentalität der Internetgeneration nur als einen Teilaspekt eines viel grösseren Problems begreift: den Niedergang unserer Kultur. Mit dem Internet seien jene Schranken gefallen, die früher Amateure von Experten trennten.
Heute ist jeder ein Filmer, der seine Werke auf Youtube lädt. Heute ist jeder ein Sänger mit einem Profil auf Myspace, ein Schriftsteller mit einem eigenen E-Book, ein Fotograf mit eigenem Tumblr-Blog. «Ich habe Angst, dass sich die Leute an Mittelmässigkeit gewöhnen», sagt der Musiker Moby im viel beachteten Dokumentarfilm «Press, Pause, Play». Im gleichen Film sagt Andrew Keen: «Seien wir ehrlich, die meisten Leute haben kein Talent.» Kultur sei per se ein elitäres Konzept und funktioniere nicht demokratisch. Kultur funktioniere auch nicht gratis. «Und darum stehen wir am Beginn einer ganz dunklen Epoche.»
In der Minderheit
Keen ist eine eindrückliche Erscheinung, ein zerfurchtes Gesicht, aus dem eine tiefe sonore Stimme kommt. Wohl nicht ganz unbewusst haben die Macher des Films den Endzeitpropheten auf einem Steg gefilmt, einen dräuenden Sturm im Hintergrund. Eine kleine ironische Überspitzung der düsteren Prognosen von Keen, die sonst überhaupt nicht zum Grundton des Films und auch zur gesamten Debatte passen. Denn noch sind jene Vertreter in der Mehrheit, die in der Demokratisierung der Kultur und der schwellenlosen Verbreitung von geistigen Inhalten eine Bereicherung unserer Gesellschaft sehen. Felix Schwenzel etwa, ein deutscher Blogger, hat schon vor zwei Jahren die «wahnwitzig bescheuerte These von der kostenlos-kultur» gegeisselt.
So seien etwa MP3s nicht populär geworden, weil sie umsonst waren, sondern weil sie immer und sofort verfügbar waren. «Kostenlos ist ein Betriebsunfall. Die Musikindustrie, die Zeitungsverlage haben es in der dreissigjährigen Geschichte des Internets bis heute nicht geschafft, einfache, schnelle und faire Bezahltechnologien zu entwickeln.» Wer das hingegen hinbekommen habe, seien Apple, Google oder Amazon. Sie verdienen heute gutes Geld. Schwenzel in seinem Blog: «Die Klageweiber, die die kostenlos-kultur ständig beklagen, sind die doppelten Loser. Sie bekommen nichts vom Kuchen ab und wissen gleichzeitig, dass das ihrem eigenen Versagen geschuldet ist.»
Eine Aussage, die von den gleichen Studien gestützt wird, die den Rückgang der Musik- und DVD-Verkäufe festhalten. So stellt das Grundsatzpapier des Bundesrats mit einem Verweis auf eine holländische Studie fest, dass insgesamt nicht weniger Geld für die Unterhaltungsindustrie ausgegeben wird – sich die Geldflüsse aber auf andere Bereiche verschieben. Teurere Konzerte etwa oder Vermarktung von Accessoires.
«Seid kreativ!»
Dass die Konsumenten immer noch bereit sind, für Unterhaltung Geld auszugeben, das ist auch das Mantra des hiesigen Ablegers der Piratenpartei. Denis Simonet, der ehemalige Präsident der Partei, schreibt auf seinem Blog einen offenen Brief an Reto Burrell, den Vorsitzenden der Musikschaffenden Schweiz und beklagt darin die Ideenlosigkeit der Schweizer Musiker: «Für den Einheitsbrei will niemand mehr Geld ausgeben. Schon gar nicht, wenn er nur auf einer Plastikscheibe erhältlich ist. Man kauft nicht länger ganze Compilations, um schliesslich ein Lied darauf zu hören. Die Fans haben die freie Wahl. Und dadurch eine neue Erwartungshaltung. Es gilt, kreativ zu sein!»
Vor allem die letzte Aussage dürfte Dirk von Gehlen unbesehen unterschreiben. Er ist im deutschsprachigen Raum einer der berühmtesten und bestgehörten Vertreter jener Fraktion, die in der technologischen Entwicklung mehr Möglichkeit als Gefahr sehen. Der Leiter von «Social Media» bei der «Süddeutschen Zeitung» hat mit «Mashup» das Buch zur Gratisdebatte geschrieben, im Herbst wird er den Nachfolgeband «Eine neue Version ist verfügbar» veröffentlichen. Einer seiner im Internet meistverbreiteten Sätze lautet: «Die digitale Kopie ist eine historische Ungeheuerlichkeit. Sie ermöglicht erstmals in der Geschichte der Menschheit das identische Duplikat eines Inhalts. Die Gesellschaft muss dringend eine Lösung für das Dilemma schaffen, in das die digitale Kopie sie gestürzt hat.» Eine Lösung könne nur auf Basis von Einsicht in die technische Neuerung gefunden werden.
Das richtige Angebot
Teile einer solchen Lösung sind bereits heute zu erkennen. So gibt es Firmen, die mit einem neuen Geschäftsmodell erfolgreich gegen die angebliche Gratismentalität antreten. iTunes von Apple wurde zuerst belächelt und ist heute ein fixer Bestandteil der Musikindustrie. Und bereits wieder veraltet: Heute laden die Nutzer nicht mehr runter, sie streamen – nutzen Medien also direkt im Internet. Und wenn das Angebot stimmt, sind die Nutzer auch tatsächlich bereit, dafür zu bezahlen.
Seit einem knappen Jahr bietet der Dienst «Spotify» in der Schweiz ein Bezahlmodell seines Musikdienstes an. Weltweit hat Spotify 15 Millionen Nutzer, 4 Millionen davon zahlen dafür und bekommen so ihre Musik werbefrei gestreamt. «Spotify könnte ein Zukunftsmodell sein», meinen Martin Wüthrich von der Suisa und auch andere Branchenvertreter. Voraussetzung: «Die Performance von Streaming-Angeboten müsste sich hinsichtlich Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit kaum mehr von Downloads unterscheiden – insbesondere bei der mobilen Nutzung», wie Lorenz Haas, Geschäftsführer des Branchenverbands IFPI, sagt. Noch ist das Zukunftsmusik: Am Donnerstag wurde bekannt, dass Spotify in den vergangenen zwei Jahren 70 Millionen Euro Verlust eingefahren hat.
Bitte ruhig bleiben
Und wie soll nun die offizielle Schweiz auf diese Debatte reagieren? Was soll der Leiter der Arbeitsgruppe Urheberrecht, der langjährige Bundesangestellte Roland Grossenbacher mit all diesem Wissen tun?
Nicht den Kopf verlieren, rät der Freiburger Wirtschaftsprofessor Volker Grossmann, und sich an den Realitäten der Gesellschaft orientieren. In einem Beitrag für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» zitiert Grossmann den IT-Experten Ray Kurzweil, der eine interessante Beobachtung zur Gratismentalität der Menschen gemacht hat. So telefonieren die meisten Menschen immer noch brav bei einem Telefonanbieter und bezahlen dafür – obwohl sie das auch gratis übers Internet tun könnten. «Der Preis des Telefonierens wird als gerechtfertigt angesehen, ganz im Gegensatz zu den Preisen für Produkte der Unterhaltungsindustrie», schreibt Grossmann und leitet daraus eine für Grossenbacher interessante Schlussfolgerung ab: «Gesetze, die dem Rechtsempfinden zuwiderlaufen, sind auf die Dauer nicht durchzusetzen. Mehr noch: Sie zerstören den Glauben an die Gesetzlichkeit. Somit besteht die Gefahr, dass das ohnehin schon problematische Verhältnis der Bürger zum Staat weiteren Schaden nimmt.»
Grossenbacher ist sich dessen bewusst. Er weiss, dass der Verein der Musikschaffenden gerne den in der Schweiz zulässigen Download illegaler Angebote zum Eigenbrauch verbieten würde. «Weil es schwierig ist, an das Gewissen zu appellieren, wenn etwas eigentlich legal ist», wie es Christoph Trummer von den Musikschaffenden sagt. Grossenbacher weiss auch, dass die Piratenpartei das Urheberrecht in seiner heutigen Form am liebsten abschaffen würde und sich mit Händen und Füssen gegen ein Verbot der Downloads wehrt, «weil das zur Kriminalisierung und Überwachung von Tausenden Internetnutzern führen würde», wie es Denis Simonet in seinem Blog schreibt.
Selbstverständlich weiss Grossenbacher das alles. Er hat es nicht zum ersten Mal mit Vertretern von gänzlich unterschiedlichen Interessen zu tun. «Das Wichtigste ist, dass alle an einen Tisch sitzen», sagt der Leiter des Instituts für Geistiges Eigentum. «Und dann schauen wir, was geschieht.» Das Mandat der Arbeitsgruppe sei relativ breit: Man könne Visionen für ein gänzlich neues Konzept von Urheberrecht entwickeln, könne kurz- und mittelfristige Änderungen vorschlagen. Alles sei möglich. «Mein Ziel wäre es, dass die Akteure gemeinsam neue Lösungen finden.» Pragmatische und technisch umsetzbare Lösungen.
Ein Beamter der Avantgarde
Klar ist für Grossenbacher, dass die Schweiz weiterhin den Endbenutzer, den Downloader nicht kriminalisieren soll. «Da bleiben wir liberal.» Er glaubt nicht an die Notwendigkeit, die Mitglieder der «Generation gratis» mit Staatsgewalt auf die richtige Spur zu bringen, wie es in Deutschland diskutiert und in Frankreich erfolglos praktiziert wird. Ja, Grossenbacher glaubt nicht einmal an die Existenz der «Generation gratis». «Sonst gäbe es doch nicht virtuose Akteure, die mit neuen Geschäftsmodellen sich im Internet eine goldene Nase verdienen. Was einem etwas wert ist, dafür bezahlt man auch.»
Der Leiter des Instituts für Geistiges Eigentum mag zwar nicht wissen, wie man per Rapidshare die neueste Folge von «Newsroom» oder von «Homeland» herunterlädt. Aber seine Ansichten zur Nutzung von digitalen Inhalten sind, man kann es nicht anders sagen, ziemlich Avantgarde.
Quellen
Das Standardwerk «Free Culture» von Lawrence Lessig
Fragen und Antworten zum Urheberrecht
Die Brandrede von Sven Regener
Artikel von Volker Grossmann und Guy Kirsch in der FAZ
«Sofort-Kultur» ein Beitrag von Felix Schwenzel in «screen.tv»
Felix Schwenzel über Filesharing und Bezahlschranken
«20 Minuten» über die Suisa und Youtube
Der «Tages-Anzeiger» über das «Guantanamo des Urheberrechts»
Mashup, das Buch von Dirk von Gehlen
Der Dokumentarfilm «Press, Pause, Play»
Artikelgeschichte
Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 24.08.12