Konkurrenzdruck, Ausbeutung, lasche Kontrollen – Das Geschäft mit dem gekauften Sex wird rauer.
Vor dem «Adagio», einer Kontaktbar im Kleinbasler Rotlichtviertel.
«Come inside?»
«No, thanks.»
«I like you, let’s fuck», sagt sie, und es klingt wie eine Drohung.
«We’re fine, thanks.»
«I suck dick.»
«I said we’re fine, thanks.»
Drinnen und draussen befinden sich vielleicht zehn Frauen, alle dunkelhäutig, alle schlecht gelaunt. Wir gehen weiter, die Frauen reagieren ungehalten, sie stehen unter Druck. Ihre Zimmer teilen sie jeweils mit einer Kollegin. Beide zahlen dafür zwischen 100 und 150 Franken pro Tag. Manche bietet ihre Dienste für 40 Franken an. Wollen sich die Frauen nicht verschulden, müssen sie also vier Kunden täglich bedienen und haben so selbst noch nichts verdient.
In den sogenannten Toleranzzonen ist das Anwerben von Kunden auf der Strasse erlaubt. Dies ist im Kleinbasel im Geviert Ochsengasse/Webergasse der Fall und im Grossbasel beim Güterbahnhof Wolf. Hier arbeitet das Prekariat des Sexgewerbes. Viele dieser Frauen können kaum Deutsch, und sie sind jeweils nur für sehr kurze Zeit in der Stadt. Diejenigen unter ihnen, die aus einem Drittstaat kommen, also weder aus der EU noch aus dem Schengenraum, sind als «Touristinnen» hier. Was sie tun, ist illegal.
Der Konkurrenzdruck wächst
Die Zahl der Sexarbeiterinnen in Basel hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Der Zuwachs von rund 1500 Prostituierten innerhalb von vier Jahren ist auf die Erweiterung der Personenfreizügigkeit zurückzuführen, die Frauen stammen fast alle aus Osteuropa. Sie dürfen mittels Meldeverfahren 90 Tage pro Jahr bewilligungsfrei in der Schweiz arbeiten. Die meisten tun dies in den Toleranzzonen.
So ist ein massives Überangebot an Frauen entstanden, die Nachfrage blieb gleich. Auch die Anzahl Kontaktbars und Saunaclubs ist stabil. Damit erklärt sich auch die kurze Aufenthaltsdauer. Ein Clubbetreiber kann es sich nicht leisten, seinen Kunden monatelang die gleiche Auswahl zu bieten, der Durchlauf ist immens. Dies erhöht den Druck auf die Frauen zusätzlich, die Preise sind am Boden.
Alle diese Umstände führen bei den Sexarbeiterinnen zu noch stärkeren Abhängigkeitsverhältnissen mit Zimmervermietern, Zuhältern sowie Betreibern von Salons, Clubs und Bars. Sie sind in der Ausübung ihrer Arbeit nicht mehr frei, können sich die Freier nicht auswählen und müssen auch auf die Wünsche eingehen, die sie gar nicht befriedigen wollen. Sex ohne Kondom ist so ein Wunsch. Mit fatalen Folgen für die Gesundheit, sagt Daniel Stolz von der Aids-Hilfe beider Basel und FDP-Nationalrat: «Die Kombination aus finanziellem Druck, Drogen und Alkohol ist eine tickende Zeitbombe.»
Nur Bar- und Salonbesitzer profitieren
Profiteure dieser Entwicklung sind einzig die Besitzer von Bars und Liegenschaften. Und natürlich die Freier. Diese können sich nach bezogener Dienst-leistung auf Online-Portalen wie sexy-tipp.to oder and6.ch über die einzelnen Frauen auslassen, die Lokale bewerten und das Preis-Leistungs-Verhältnis beklagen. Das klingt in der harmlosen Version dann etwa so: «Service guter Durchschnitt mit FM [Französisch mit Kondom], ZK [Zungenküsse] und 3 Stellungen.» Nach Medienberichten über den Preiszerfall im Milieu hätten Freier gar auf die neuen tieferen Preise gepocht, erzählt eine Frau.
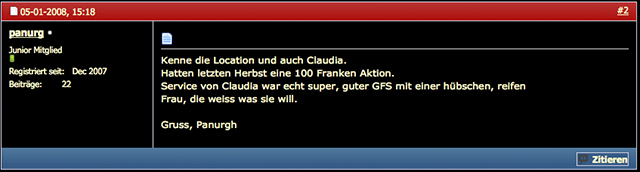
(Bild: Screenshot www.sexy-tipp.to)
Treffen mit einem Branchenkenner im Hotel Radisson an der Steinentorstrasse. Der Mann ist seit vielen Jahren als Unternehmer im Milieu tätig. Er will vom Geschäft mit der Lust erzählen, weil so viele falsche Vorstellungen über das Rotlichtmilieu in Basel kursieren würden. Eine der Illusionen: Mit Prostitution lasse sich ein Haufen Geld verdienen. «Sex kostet heute nichts mehr», sagt Freddy Amstutz (Name von der Redaktion geändert). Rentabel seien nur noch der Luxusbereich und der Discountsex in Saunaclubs oder grossen Bordellen. Alle anderen Bereiche hielten sich nur noch knapp über Wasser. «Fastfood-Sex» nennt Amstutz diese neue, «erfolgreiche Geschäftsidee». In diesen Clubs seien die Preise standardisiert, die Dienstleistungen auch. Entsprechend sei dann auch die Qualität von Service und Frauen.
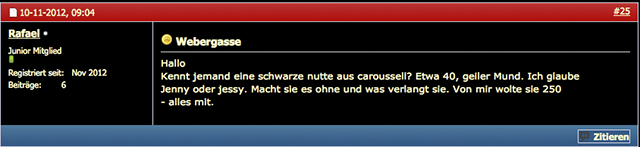
(Bild: Screenshot www.sexy-tipp.to)
Und Frauen braucht es viele. Ein Salonbetreiber ist auf den steten Zufluss angewiesen, weil die Prostituierten nie lange im Land bleiben dürfen. Die Versorgung mit Frauen geschehe meist über illegale Vermittler im Ausland. Zwar würden sich die Frauen bewusst für die Prostitution entscheiden – ohne Ausbeutung, ohne Druck, ohne Zuhälterei geht es dennoch kaum.
Amstutz rührt in seinem Caffè Latte, ist ganz Unternehmer. «Man erhält ständig Anrufe von Zigeunern aus Bulgarien oder Rumänien, die vier, fünf Frauen im Angebot haben. Die steigen in einen Bus, und später klopft ein Typ mit vier Frauen im Schlepptau an der Türe.»
Wolle man auf der sicheren Seite sein, schicke man solche Typen weg und verhandle direkt mit den Frauen, sagt Amstutz. Liefern die Prostituierten abends ihren Tagesgewinn dem Zuhälter ab, gehe das den Salonbetreiber nichts an. «Ich habe keine moralischen Prinzipien beim Geschäften. Solange ich im legalen Bereich bin und die Rechnung aufgeht, habe ich keine Probleme damit.»
Die Polizei schaut weg
Der Polizei, sagt Amstutz, seien all diese «halbseidenen Praktiken» bekannt. Fälle von Korruption und Bevorteilung, wie sie in Zürich publik wurden, kenne er jedoch nicht. Andere Stimmen aus der Branche bestätigen diese Einschätzung. Amstutz’ Erklärung dafür ist profan: «Es gibt in Basel viel zu wenig Geld zu verdienen, als dass sich jemand eine wirksame Bestechung leisten könnte.»
Basel unterscheidet sich auch in einem anderen Punkt von der Limmatstadt: In Zürich waren sich Behörden und Milieu zu nahe, in Basel ist das Gegenteil der Fall. Hier misst die Polizei nach eigenen Angaben der Überwachung des Sexgewerbes keine Priorität zu. Man könnte auch sagen: Sie schaut weg. Und dies, obwohl es manchmal rau zu- und hergeht. Inzwischen wird der Konkurrenzkampf unter denjenigen, die an den Frauen verdienen, immer härter geführt. Einmal erfolgt eine Attacke mit Buttersäure auf ein erfolgreiches Etablissement, ein anderes Mal brennt der Hummer eines Sexclubbetreibers.
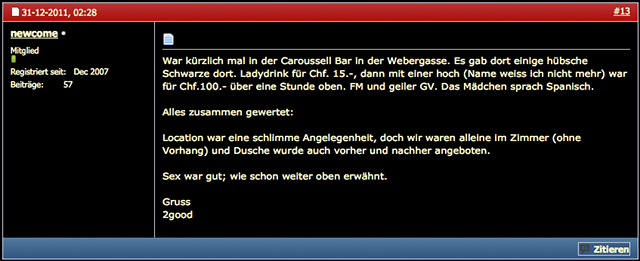
(Bild: Screenshot www.sexy-tipp.to)
Politiker aller Couleur und Vertreter der Justiz bemühen sich stets, das Sexgewerbe als ein ganz normales Gewerbe zu bezeichnen. Dass dies nicht viel mehr als ein Gemeinplatz ist, zeigt ein Gespräch mit Susanne Bertschi. Die Juristin arbeitet eng mit der Beratungsstelle für Frauen im Sexgewerbe zusammen, etwa wenn es darum geht, ausstehende Honorare einzufordern.
Frauen, die in einem Stripclub als Tänzerin arbeiten, sind dort in der Regel angestellt und verfügen über einen Vertrag. Der Mindestnettolohn beträgt 2300 Franken pro Monat. Es komme jedoch regelmässig vor, dass die Betreiber den Frauen nicht das ganze Gehalt auszahlten, sagt Bertschi: «Sie sagen dann, dass sie nicht oder nur schlecht gearbeitete habe.» Schon alleine die Tatsache, dass solche Lohnstreitigkeiten, verglichen mit anderen Niedriglohnbranchen, überdurchschnittlich häufig vorkämen, spreche Bände. «Diese Frauen sind in einer schlechten Position, wenn es darum geht, ihre Rechte durchzusetzen. Sie wollen es sich nicht mit dem Clubbetreiber verscherzen und wissen zudem kaum um ihre Rechte.»
Bertschi bezeichnet ihre Erfolgschancen vor Gericht als bescheiden. Fast immer sei die betroffene Frau zum Zeitpunkt der Verhandlung ohnehin nicht mehr anwesend. «Dann kann der Betreiber erzählen, was er will, es findet keine echte Konfrontation statt.»
Stripclubs beziehungsweise Cabarets sind in Basel etwas aus der Mode gekommen. Das Interieur im «Red Palace» zeugt von früheren Zeiten, als Geld und Champagner im Gleichklang sprudelten: roter Satin, goldene Statuen im ägyptischen Stil, da und dort ein wenig Zebra und Leopard. Das «Le Privé» setzt auf rotes Leder, grosse Champagnerflaschen und Zigarren. Die Tänzerinnen in diesen Lokalen dürfen sich nicht prostituieren, dennoch erhalten wir in einem Club entsprechende Angebote.
Die Dienstleistungen sind mit dem Kauf von Champagner verknüpft und somit doppelt verboten. Einen Lapdance gibt es ab 80 Franken, wenn wir aufs Zimmer wollen, muss es schon eine der teuren Flaschen sein (etwa ein «Dom Perignon Vintage» für 790 Franken). Auch ein kurzes Gespräch ist an eine Getränkebestellung gebunden. Damit verstossen die Betreiber gegen das Animationsverbot. Dieses untersagt ihnen und den Frauen, die Gäste zum Konsum alkoholischer Getränke zu animieren.
Auch die Damen sind gezwungen, ständig zu trinken. Ihren Champagner verdünnen sie mit haufenweise Eis, die Cocktails (45 Franken) scheinen vor allem aus Fruchtsaft zu bestehen. Pro Getränk erhalten die Frauen bescheidene Anteilsprozente, bei einer kleinen Flasche Champagner für 125 Franken sind es vielleicht 10 Franken. Jede Minute, in der sie sich nicht von einem Gast auf ein Getränk einladen lassen, ist eine verschenkte Minute. Sie sind zum Arbeiten hier, auch wenn sie «let’s make party» sagen. Sie müssen Interesse vortäuschen, auch wenn sich die Biografien der Gäste wohl gleichen. Sie müssen lachen, auch wenn ihr Gegenüber sie begrapscht.
Ein Freier zeigt einer Frau Fotos. Vielleicht von seiner Familie. Prostitution ist zuweilen mehr als Sex.
Anna aus Spanien erzählt: «Ich war Grafikerin in Madrid. Aber das Geschäft lief schlecht, ich wurde entlassen. Alle haben Schulden, ich auch. Ich will mich selbstständig machen, dazu brauche ich Geld.» Eine Bekannte habe ihr erzählt, dass man in der Schweiz als Tänzerin gutes Geld verdienen könne. Über eine Agentur sei sie dann hierher gekommen. «Die haben alles organisiert. Zuerst war ich einen Monat in Zürich, jetzt ist Basel dran, und danach gehe ich noch für einen Monat nach Luzern.» Es sei nicht einfach, sagt die junge Frau. «Alle Männer haben andere Wünsche, manche wollen dich gleich heiraten, andere wollen dich bloss ein bisschen anglotzen. Was ich hier wirklich tue, weiss nur mein Bruder.»
In Basel werden Gesetzesverstösse im Milieu hingenommen – wie in keinem anderen Kanton. Zweifelhafte Geschäftspraktiken wie jene der Kontaktbars werden in dieser Weise fast nur noch in Basel toleriert.
Ein Streifzug durchs Kleinbasler Bermuda-Dreieck: «Roter Kater», «Bermuda-Bar», «Adler», «Adagio». Drei, vielleicht vier Kunden sitzen an der Bar, jeweils eine Frau an der Seite, ein Piccolo, selten eine kleine Flasche Champagner auf dem Tresen. Ein Freier sitzt an einem Tisch, hantiert an seinem iPhone und zeigt der Frau Fotos. Von den letzten Ferien vielleicht. Oder von seiner Familie. Prostitution ist zuweilen mehr als Sex.
Flora und Lucia setzen sich zu uns. Flora lebt eigentlich in der Dominikanischen Republik, Lucia in Kuba. Für wenige Wochen sind sie in Basel, mit welcher Bewilligung sie hier arbeiten, ist unklar. Südamerikanerinnen haben eigentlich keine Chance, als Prostituierte in der Schweiz tätig zu sein. Sie bitten darum, Champagner zu bestellen.
Horrende Zimmerpreise
Animiert wird in allen Kontaktbars, offen, nicht verborgen. Geraucht wird auch fast überall. Die Betreiber verpflichten die Mädchen, Champagner zu bestellen, bevor sie mit den Freiern aufs Zimmer gehen. Flora und Lucia brauchen das Geld. Und im Moment läuft das Geschäft schlecht, erzählt Lucia. An guten Tagen hat sie vielleicht drei Kunden, an schlechten gar keine. Vom kargen Erlös muss sie die Zimmermiete begleichen, die zwischen 400 und 500 Franken die Woche beträgt. Sie muss die Reise bezahlen und ihren Lebensunterhalt.
Lucia kann gut Deutsch. Bevor sie nach Basel gekommen sei, habe sie eine Latino-Bar in Wien besessen. «Es war eine ehrliche Arbeit», wie sie erzählt. Dort habe sie manchmal als Sängerin mit ihrer Band Musik gemacht. Dann habe das Lebensmittelinspektorat den Stecker gezogen. Zu Hause in Kuba arbeite sie als Immobilienagentin, sagt sie, ihre Ferien verbringt sie jeweils in der Schweiz. Daheim weiss niemand, was hier mit ihr geschieht.
Dass es der Polizei nicht gelingt, das Animierverbot durchzusetzen, ist wenig erstaunlich, wenn man weiss, welche Ressourcen dafür eingesetzt werden müssen. Für Aufsicht und Kontrolle der Lokale in der Rotlichtszene ist die Milieufahndung der Kantonspolizei zuständig. Die spezialisierte Gruppe besteht aus lediglich vier Personen. Ziel sei es, jedes der über 230 Etablissements mindestens einmal pro Jahr aufzusuchen, erklärt Fahndungschef Urs Wicki. «In erster Priorität sucht die Fahndung immer nach Hinweisen bezüglich Menschenhandel und Förderung der Prostitution», schreibt Polizeisprecher Andreas Knuchel auf Nachfrage. Werden solche Hinweise gefunden, gelangen die Rapporte an die Staatsanwaltschaft. Je nach Delikt ist dort eine andere Gruppe zuständig, eine auf das Milieu spezialisierte Ermittlungseinheit gibt es nicht. Am «Runden Tisch Prostitution» klären Verwaltung, Justiz und private Organisationen zweimal jährlich interne Abläufe. Mangels Diskussionsbedarf fiel die letzte Sitzung aus.
Die Justiz fokussiert sich auf die schlimmen Missbräuche im Milieu, alltägliche Verstösse können kaum geahndet werden. Und sollte doch einmal ein Betreiber einer Kontaktbar gebüsst werden, kann dieser die Summe locker bezahlen. Dieses Risiko wird in Kauf genommen. Alle tun es, alle wissen es.
Anders als in Basel ist die Prostitution etwa im Tessin gesetzlich geregelt. Seit zwei Jahren geht die Polizei konsequent gegen illegale Sexarbeit vor. Seit Beginn der «Aktion Domino» 2012 wurden sämtliche Sexbetriebe im Kanton überprüft, oft mittels Grossrazzien. Über 30 Betriebe mit illegalen Prostituierten, die ausgebeutet wurden, mussten schliessen.
Das Basler Milieu rüstet sich derweil für den nächsten Ansturm der Frauen – auf jene Erweiterung des Angebots, wenn die Kontingente für Arbeitskräfte aus Bulgarien und Rumänien Ende Mai 2014 fallen. In der Toleranzzone wird Haus um Haus aufgekauft und in eine Kontaktbar oder in Verrichtungszimmer umgewandelt. Hausbesitzer erzählen von Besuchern mit viel Geld in Koffern, die ganze Liegenschaften gegen Bargeld erwerben wollen.
Die erwartete Zunahme an Wanderprostituierten aus Südosteuropa wird zu einem weiteren Preisdruck führen. Die Frauen werden noch mehr Mühe haben, auf dem Strich genug zu verdienen. «Legale Prostitution wird immer schwieriger», sagt Viky Eberhard von der Basler Beratungsstelle Aliena. Die Mädchen würden schon heute das kleinste Stück vom Kuchen abbekommen. Den Profit streichen andere ein, die Zimmervermieter, die Betreiber der Kontaktbars und der Discountsex-Etablissements.
Kriminalisierung wäre fatal
Vielleicht wird das Anschaffen ganz verunmöglicht. In Bern fordern Politiker aus allen Lagern den Bundesrat auf, ein Prostitutionsverbot in der Schweiz zu prüfen, wie es in Schweden bereits gilt und in Irland und Frankreich diskutiert wird. Dies, obwohl die kontraproduktiven Auswirkungen von Prostitutionsverboten in mehreren Studien nachgewiesen worden sind. Viky Eberhard hält dies für den komplett falschen Weg, weil ein Verbot die Prostituierten noch anfälliger für Ausbeutung machen würde. Auch Daniel Stolz von der Basler Aids-Hilfe warnt davor: «Die Kriminalisierung der Freier und später der Frauen macht deren Lage noch schwieriger. Diese ist jetzt bereits prekär genug.»
Es gibt andere Massnahmen, die wirklichen Nutzen bringen würden. Andrea Caroni, ein Parteikollege von Stolz, verlangt eine Verbesserung der rechtlichen Stellung von Sexarbeiterinnen. Er fordert die Aufhebung der sogenannten Sittenwidrigkeit, mit der das Bundesgericht noch immer die Prostitution beurteilt. Das hat zur Folge, dass Prostituierte nicht vor Gericht gehen können, um die Einhaltung von Verträgen einzuklagen, etwa wenn ein Freier nicht bezahlen will. Für Eberhard würde es schon reichen, wenn die Basler Polizei die Gesetze konsequent durchsetzen würde, etwa das Animierverbot. Damit würde sich auch die gesundheitliche Situation verbessern, da die Frauen dann nicht mehr so viel Alkohol konsumieren müssten. Auch der Opferschutz muss ausgebaut werden, fordern die Kritiker eines Prostitutionsverbots. Und illegale Prostituierte müssten auf Zwang und Missbrauch aufmerksam machen können, ohne dass ihnen Repressalien drohen. Dann könnten sich die Frauen endlich selber helfen.
Artikelgeschichte
Erschienen in der Wochenausgabe der TagesWoche vom 29.11.13
