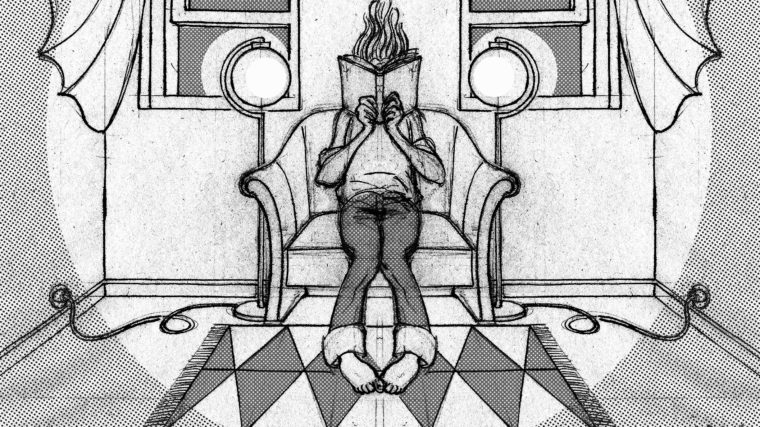«Ach, wenn’s mir nur gruselte!» Das Angsthaben ist für die meisten Menschen keine Kunst: Ob Schlangen, Umweltgifte oder Gewalttäter – Grund zum Fürchten gibt es eigentlich immer. Johannes Binotto begnügt sich in seinem Buch «Tat/Ort» allerdings nicht mit einer Inventur der Phobien. Frei nach Freud begreift der Kulturwissenschaftler das Unheimliche als Raum, in dem wir unserer grössten Furcht begegnen: uns selbst.
Dieses Prinzip erläutert Binotto anschaulich anhand von Beispielen aus Literatur, Film und Kunst, die von Giovanni Battista Piranesi bis H.P. Lovecraft und Dario Argento reichen. Von den akademischen Fussnoten, die Schlange stehen, sollten sich Interessierte deshalb nicht abschrecken lassen: «Tat/Ort» ist eine spannende Lektüre, die ihre Leser auf eine Entdeckungsreise ins eigene Hinterstübchen mitnimmt. Wir haben uns mit dem Autoren unterhalten.
Herr Binotto, wie sind Sie auf das Unheimliche als Thema gestossen?
Das geht bis in meine tiefste Kindheit zurück. Was mir Angst macht, hat mich schon immer fasziniert: «Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen» war mein absolutes Lieblingsmärchen. Und ich erinnere mich, wie ich im Primarschulalter aus dem Fenster im Erdgeschoss geklettert bin, um in der Nacht auf dem Friedhof sein zu können. Später habe ich mich intensiv mit Horrorfilmen und Edgar Allen Poe beschäftigt, bis ich die Psychoanalyse für mich entdeckte. Darin fand ich plötzlich Beschreibungen von Dingen, die ich selbst gruslig fand. Es kam zu einer Verlagerung: Nicht ein Objekt an und für sich ist unheimlich, sondern eine Situation, eine Form. Das ist der zentrale Gedanke: Das Monster ist weniger schrecklich als die Ungewissheit, der Verdacht, dass hinter der Türe etwas lauert.
War die Psychoanalyse für Ihre Untersuchung deshalb so fruchtbar, weil sie als Theorie selbst bildhaft ist?

Johannes Binotto
Der Kulturwissenschaftler ist Assistent am Englischen Seminar der Universität Zürich, wo er mit seiner Studie zum Unheimlichen promoviert und dafür den Jahrespreis 2011 der Philosophischen Fakultät gewonnen hat. Er leitet Seminare zum Thema «Film & Psychoanalyse» und schreibt als freier Autor für diverse Zeitungen und Zeitschriften.
Es ist schon so, dass die Psychoanalyse sehr bild- und textaffin ist. Jacques Rancière hat einmal gesagt, dass Freud die Literatur und die bildenden Künste nicht gebraucht hat, um seine Theorie zu illustrieren, es war eher umgekehrt: Was Freud als das Unbewusste bezeichnete, war etwas, was die Künste schon längst entdeckt hatten.
Haben Sie sich selbst einmal einer Psychoanalyse unterzogen?
Habe ich nie gemacht und werde ich wahrscheinlich auch nie tun. Bei Freud gibt es den Begriff des «wilden Analytikers», der undiszipliniert mit dem psychoanalytischen Werkzeug hantiert – so sehe ich mich. Ausserdem glaube ich, dass man eine Analyse nicht ohne Leidensdruck einfach nur zum Plausch macht. Auch wenn mein Buch persönlich ist, tun sich darin keine Abgründe auf: Ich komme mit meinen Neurosen ganz gut zurecht.
Was hat es mit der Fotografie Ihres eigenen Kellers am Schluss des Buches auf sich?
Das ist eine lustige Geschichte! Für mein letztes Kapitel wollte ich unbedingt ein Bild von Gregor Schneiders «Haus u r» zeigen, allerdings scheute ich den Aufwand, die Bildrechte beim Künstler abzuklären. Da fiel mir ein, dass ich ja zeigen wollte, dass wir das Unheimliche immer bei uns selbst finden. Also habe ich meine Kamera gepackt – es war nachts um eins – und habe mit Blitzlicht ein Bild gemacht: Es sieht wirklich aus wie eine Installation von Schneider!
Welche Rückschlüsse lassen die Bilder vom Unheimlichen auf unsere Gesellschaft zu?
In meinem ersten Kapitel erwähne ich Adorno und Horkheimer: Kultur kann nie ganz befriedet werden, sie produziert ihr Gegenteil immer mit. Das entspricht der Dialektik der Aufklärung, die alle Unwägbarkeiten beseitigen will, sie dadurch aber nur noch verstärkt. Das ist auch der Clou am Unheimlichen bei Freud: Jedes Heim ist unheimlich, es geht gar nicht anders. Versucht man, das Heim zu säubern, wird es nur noch schlimmer. Dasselbe in der Psychoanalyse: Wird eine diffuse Angst nicht mehr auf ein Symptom gebündelt, ist sie plötzlich überall.
Die Burka ist so ein Fokus…
Richtig, hier werden Ängste deponiert in der Hoffnung, dass sie auch dort bleiben. Genau das finde ich im Umgang mit dem Unheimlichen so problematisch. Diese Versessenheit, ein Objekt zu benennen, um die eigene Angst zu verorten. Ich will genau das Gegenteil zeigen, dass nämlich die Unverortbarkeit selbst Angst macht.
Ist es diese Unverortbarkeit, die virtuelle Räume wie das Internet neuerdings wieder in Verruf bringt?
Nehmen wir den romantischen Reiz der meisten Horrorfilme als Gegensatz: Das absolute Böse, das sich lokalisieren und klar benennen lässt, ist letztlich eine beruhigende Vorstellung. Die Leere hingegen, die reine Abwesenheit lässt einen verzweifeln. Wie das Callcenter zum Beispiel, das als Raum leer ist, weil niemand mehr verantwortlich ist und sich der Frust der Anrufer auf nichts mehr richten kann. Das ist die Art von Kerker, wie sie Piranesi in seinen «Carceri» gezeichnet hat – ein Gefängnis, das einen nicht durch seine Begrenzung, sondern durch seine schiere Ausdehnung gefangenhält.
Johannes Binotto: «Tat/Ort. Das Unheimliche und sein Raum in der Kultur». Diaphanes Verlag 2013. 352 S., ca. Fr. 40.–.