Der libanesische Musiker Rabih Abou-Khalil spricht über sein neues Album «Hungry People». Der Worldjazz-Pionier hat auch nach 20 Jahren im Geschäft nichts von seinem Hunger und Esprit verloren. Und doch sagt er im Interview über seine Musik: «Bei mir schwingt immer etwas Komisches mit.»
Als ein Pionier des Worldjazz hat er seit den 1980er-Jahren einem europäischen Publikum arabische Töne nahe gebracht. Viele haben durch Rabih Abou-Khalil das Lauteninstrument Oud kennen gelernt. Dabei war er stets ein Wanderer zwischen den Welten: Mit seinen libanesischen Wurzeln und seiner klassischen westlichen Ausbildung schuf er eine ganz neue Instrumentalmusik. Nun stellt der 55-Jährige sein neues Album «Hungry People» vor.
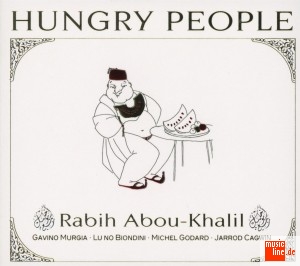
«Hungry People»-Cover
Rabih Abou-Khalil, auf Ihrem neuen Album sieht man nicht wie auch schon aufwändige Kalligraphien, sondern einen Cartoon mit einem fetten Mann, der eine goldene Melone isst. Was verbirgt sich dahinter?
Zum einen fand ich das Paradox gut, denn die CD heisst ja «Hungry People» – will sagen: Die Fetten essen den Armen alles weg. Doch es geht auch um den Hunger jenseits der Nahrung, einen Hunger nach Spielen, nach Ausdruck, den meine Band und ich auch nach 20 Jahren auf der Bühne noch verspüren, wo sich andere Gruppen schon längst zerfleischt hätten.
Ist «Hungry People» in Übereinstimmung mit dem Coverbild ein satirisches Album, mehr als die vorangegangenen?
Bei mir schwingt immer etwas Komisches mit. Es ist wichtig, dass Musik nicht zu ernst ist, sie verliert dann doch von ihrem Charme, so ähnlich wie ein Mensch, der immer ernst ist, irgendwann totlangweilig wirkt. Mit Ironie kann man die Welt besser verstehen, vielleicht sogar mit Surrealismus. Gerade die gegensätzliche Situation im Nahen Osten lässt sich so gut abbilden.
Beim Hören entsteht der Eindruck, dass Sie sich mit Ihrem Oud-Spiel zugunsten des Ensembleklangs zurücknehmen.
Da habe ich ein grosses Vorbild, das ist Miles Davis, der nie mehr gespielt hat als seine Mitmusiker und der damit der Band eine ganz andere Kohärenz gegeben hat. Ich bin der Komponist und Oud-Spieler und die Frage ist immer, wie balanciere ich das Ganze aus. Es gibt etwas sehr Wichtiges, wenn man Bandleader ist, worauf viele gar nicht achten: Ich suche als Mitmusiker Leute aus, die nicht nur für sich genommen technisch gut sind. Es kommt auch darauf an, wie die Bandmitglieder miteinander auskommen. Obwohl wir alle aus verschiedenen Kulturen kommen, es sind ja nicht zwei Leute aus dem selben Land dabei, stimmt die Chemie.
Als ich meinem ersten Oud-Lehrer meine Kompositionen vorspielte, rief er: «Halt, was soll der Blödsinn!»
Ihre Oud ist auf «Hungry People« streckenweise sogar sanglich, wie in einem arabischen Chanson.
Als ich einem meiner ersten Oud-Lehrer meine Kompositionen vorspielte, rief er: «Halt, was soll der Blödsinn, ich kann das ja alles gar nicht singen!» Und seitdem sage ich mir immer, wenn es nicht singbar ist, dann bleibt es nicht hängen, es muss einen wörtlichen Sinn ergeben. Es ist mir bewusst, dass es einen gewissen Reim, ein Gleichgewicht in der Komposition geben muss von Sprache und Musik, auch wenn es nur eine apostrophierte Sprache ist.
In diesen Zusammenhang passt gut, dass Sie auf «Hungry People» rein instrumentale Kommentare zu aktuellen Themen geben, etwa im «Bankers‘ Banquet», ein turbulentes, fast groteskes Stück.
Meine Kompositionen tragen oftmals eher abenteuerliche Namen, damit die Hörer mehr hineinfantasieren können, ich mag keine tiefgründigen Titelgebungen. Warum schreibt man Instrumentalstücke? Weil man das, was man spürt, nicht genau in Worte fassen kann. Und dann soll man am Ende wieder einen Titel dafür finden! Andere Titel sind von ihrer Titelgebung eher düster, wie «Dreams Of A Dying City», das Sie schon wiederholt aufgenommen haben. Ursprünglich wurde es für Beirut geschrieben, heute könnte man es auf die Nachbarstädte Damaskus und Aleppo übertragen.
Kostprobe vom neuen Album: «Dreams Of A Dying City»
Hat der arabische Frühling aus Ihrer libanesischen Perspektive gesehen eine Zukunft?
Ich habe Angst, dass er in einen Winter umschlägt und ich befürchte, dass wir eine religiös geprägte Bewegung haben werden. Es hat alles sehr faschistoide Züge und man kannte das in Europa ja das ganze Mittelalter durch. Man darf nicht nur an die grossen Städte wie Damaskus und Kairo denken, an die intellektuelle Protestbewegung der Hauptstädte. Die riesengrosse Landbevölkerung spielt eine erhebliche Rolle und bei der ist eher das religiöse Zugehörigkeitsgefühl ausschlaggebend und darin auch noch der Extremismus, der ökonomische Gründe hat. Da sind wir bei einer weiteren Bedeutung meiner «Hungry People»! Leute die nicht gebildet werden, können ihren Hunger in jeder Hinsicht gar nicht stillen.
Zuletzt noch eine persönliche Frage: Nach vielen Jahren in München sind Sie nun an der Côte D’Azur ansässig und haben auch Ihr Label gewechselt. Warum?
Südfrankreich erinnert mich an meine erste Heimat Libanon. Und jetzt, wo meine Kinder gross sind, möchte ich ein bisschen mehr Sonne geniessen. Mein Abschied von Enja Records ist keiner im Zorn, ich hatte dort grosse Freiheiten all die Jahre. Aber nach sechzehn Alben wollte ich etwas Neues probieren. Auch wenn ich finde, dass Deutschland eines der entspanntesten Länder geworden ist. Die relative Sicherheit sowohl im persönlichen als auch im politischen Bereich, das trägt unheimlich dazu bei, dass die Leute relaxt werden. Ich als Reisender, der viele Länder kennt, kann mir dieses Urteil getrost erlauben.
