Die Qualität und die Menge der Programmpunkte am Festival sind hoch. Was tun? Da hilft nur ein Marathon. Wir haben es ausprobiert.
Wenn ein Festival so geplant ist, wie das Theaterfestival Basel gestern Freitag, und alle Produktionen des Tages nahtlos ineinander übergehen, hilft nur eins: Zieh dir alle rein! Alle am Stück. Mein Festivalmarathon an diesem freundlich sonnigen Tag liest sich demnach folgendermassen: Am Nachmittag zur Stadtraumintervention von «ReiseBüro», am frühen Abend zur performativen Installation von «home sweet home», dann zum Tanz von Louise Lecavalier, anschliessend zur Performance von Dana Michel und schlussendlich zur Tanzperformance von Eisa Jocson. Ein halber Tag und eine halbe Nacht, alles was das Festival zu bieten hat. Und ich verpasse nichts.
ReiseBüro
Die erste Etappe meines Langlaufs ist das «ReiseBüro» von boijeot.renauld.turon. Die Franzosen habe ich vor gut einer Woche schon einmal besucht – nun möchte ich wissen, wie es ihnen nach ihrer Reise durch die Innerstadt so geht. Ihr ikonisches Bettenlager finde ich am Kleinbasler Kopf der Mittleren Brücke. Diese weisse Strahlkraft! Neben aller sozialen Wirkung schon einfach nur wunderbar skulptural. Abgesehen von jenem Müden, der rücklinks aufs Bett gestürzt seinen Bauch in der Sonne wärmt, sind die Künstler gerade wieder mal ihre Möbel am tragen. Vom Käppelijoch hierher zur gemütlichen Helvetia, wo schon etliche kleine Gesellschaften sich an ihren Tischen und in ihren Betten tummeln: verwirrte Rentner, saufende Engländer, flirtlustige Teenager, flirtunlustige Teenagerinnen, ein Pärchen, das seine Nacht plant.
Was für eine Stadt sie kennengelernt haben, auf ihrer zehntägigen Reise vom Birsfelder Roxy bis hierher, frage ich die Künstler. «Basel ist wie Modelleisenbahn, eine Postkarte!», sagt Laurent Boijeot. Alles klein, sauber, geordnet, und die Menschen seien nett aber scheu. Ein Highlight der Woche? «Paula kam aus dem Krankenhaus direkt auf den Barfüsserplatz, jubelte, sie sei vom Krebs geheilt, knallte Geld auf den Tisch und forderte Sekt!» Dass auf dem Münster ein Passant die Gruppe angriff und Möbel zertrümmerte, gehöre zum Auf und Ab ihrer Kunst. Gleich danach sei dann wieder Paula aufgetaucht, mit einem Überraschungs-Festessen. Wie viele andere, ist sie fortan immer wieder ins ReiseBüro zurückgekehrt. Für die drei sympathischen Franzosen neigt sich die Basler Reise ihrem Ende zu. Und auch wenn Laurent Boijeot mit seinem Blut unterschreiben würde, dass er diese Arbeit auch in zehn Jahren noch tun will: Die Künstler sind müde. Gerade angesichts dessen, dass sie am Sonntag nach Nancy weiterreisen, um die Reise-Aktion mit dem dortigen Bürgermeister im Sinne des Bürgerkontakts durchzuführen. Eine weitere Woche auf der Strasse.
home sweet home
Auch ich reise weiter. Müde bin ich noch nicht, allenfalls ein wenig besäuselt vom Bier am sonnigen Rhein. Vom Wohnzimmer der Strasse ins «home sweet home»: Weiter geht’s für mich in die Turnhalle Klingental. Hier basteln sich Festivalbesucher ihr eigenes Basel, eine utopische Stadt aus Kartonhäuschen. Die britische Künstlergruppe «subject to_change» sieht den Effekt ihrer performativen Installation «im Versammeln von kreativ gebauten Gemeinschaften und den Erfahrungen, die in ihnen geteilt werden». In Basel sieht das so aus: Während hauptsächlich Kinder in den Strassen der Karton-Kleinstadt rumtollen, im Kleinbasel bei der grossen Sprossenwand, begründen der Besucher Jonas und seine Freunde einen ausgewachsenen Stadtstreit. Die Anfangszwanziger gründen die private Securityfirma «Sicherheit sofort» und produzieren aufwändig kleine Werbeplakate, sogar einen Radiospot, der wiederholt über die Hallenlautsprecher in die Pappstadt dröhnt. «Sicherheit sofort, für eine bessere Zukunft!» – viele Pappstädter stehen dem Unternehmen kritisch gegenüber. Es kommt zu Protesten und Randale. Und das Gegenkomittee tritt mit Asylheim und Notschlafstelle dem populistischen Schwarzmalen der Sicherheitsfirma entgegen.

«Schade, dass sich nicht mehr Erwachsene an dem Spiel beteiligen, das einen in unbekannte Rollen schlüpfen lässt», meint Jonas, der eben von seinem Meeting mit dem Bürgermeister zurückkommt. Tatsächlich trug sich in der Modellstadt in den letzten zehn Tagen so einiges zu, das Kinder wohl nur bedingt verstehen: Eine Kleinbasler Wurstbude importierte Fleisch Deutscher Schweine, die dann genmanipuliert über die Grenze in die Schweiz ausbüchsten, weswegen ein Grenzzaun errichtet wurde, was wiederum zu massiv Gegenwehr führte und schliesslich zur Drohung, solange «I’ve Been Looking For Freedom» von David Hasselhoff im Stadtradio zu wünschen, bis der Zaun verschwände. Für Manchen wäre das bunte Turnhallentreiben wohl ein wenig arg sauglatt. Nicht so für den Autor: «home sweet home» hat Reality-Potential vom Feinsten. Und im Radio läuft «Smells like Teen Spirit».
So Blue
Die kleine grosse Turnhallenwelt hat mich glatt die Zeit vergessen lassen. Ich reisse mich los von den mitteilungslustigen Hallenbewohnern mit ihren tausend Geschichten und Geschichtchen und stürme quer über den Kasernenplatz. Es steht die heiss gekochte kanadische Tanzkönigin Louise Lecavalier auf dem Zettel. Die «Ikone», die «Vorreiterin», die Trägerin des höchsten Ordens von Kanada. Ihre Choreografie «So Blue» zeigt die 55-jährige in der ausverkauften Reithalle. Und wow: Lecavalier misst diesen graublauen, kühl leuchtenden Bühnenraum bis in den letzten Winkel aus. Sie spickt in alle Richtungen: am Boden, mal kriechend, dann fliessend, zum Deckenlicht sich streckend, mal tänzelnd, mal zuckend, wild kontrolliert. Sie rutscht auf einem Bein hüpfend, wie so oft in schmerzhafter Ausdauer. Mal murmelt sie leise, mal keucht sie laut. Ihre kleinen und grossen Gesten zielen manchmal direkt ins Publikum, doch meistens in sie hinein. Irgendwie gelenkt wirkt sie dabei oft. Hin und her geschubst. Dann aber wieder explosiv befreit.

So liest sich die Kritik eines Dilettanten. Aber besser kann ich sie nicht beschreiben. Louise Lecavalier ist atemberaubend. Ihre Gesten sind glasklar und gleichzeitig uneindeutig. Ein Rätsel dann, wenn ich sie zu durchschauen meine. Die Musik von Mercan Dede fordert viel. Treibende Trommeln, viel Kraft. Und dann diese Schlüsselszene: Lecavalier im Kopfstand, den Bauch hell entblösst, tief atmend. Der leuchtende Bauch wird zum pulsierenden Herz. Nicht so irgendwie, sondern so ganz deutlich. Und unfassbar schräg anzusehen. Das abschliessende Duett mit Frédéric Tavernini, diesem schönen Mann mit den mächtigen Armen, der aussieht wie eine Mischung aus Rasputin und Techno Viking, ist hinreissend schön, energiegeladen, verpielt, kraftvoll, romantisch. Weltklasse, würde ich mal behaupten.
Yellow Towel
Ja, die Lecavalier war eine ganz starke Nummer, die auch ganz schön viel Kraft gekostet hat. Irgendwie dauert so ein Tanztheater halt doch länger wie Theatertheater. Und die Frau hat ziemlich viel länger getanzt als programmiert, weswegen wir gleich zum Jungen Theater weitergescheucht werden. Hier warten die Leute schon auf uns, und vor allem auf «Yellow Towel», die Performance der Kanadierin Dana Michel, die die New York Times als «eigentümlich, rätselhaft, aber überzeugend und wertvoll» beschrieb.«Anstrengend aber geil», hat mich ein Freund eingestimmt. Wir werden sehen. Von der grossen, dunkelschwarzen Reithalle gehts also in den kleinen, heissen Whitecube des Jungen Theaters, wo beriets die Fächer zum Selbstbewinden bereitliegen. Weisse Vorhänge, weisser Boden, ein Tisch mit weissen Tuch, ein weisser Plastikhocker. Und am Bühnenrand kommt sie langsam hinter dem Vorhang hervor: Dana Michel, die vor ihrem späten Tanzstudium Marketing-Managerin und Spitzensportlerin war.

Michel ist schwarz und trägt schwarz. Schwarze Frau im weissen Raum, soweit so klar. Schwarze Frau, gelbe Banane, gelbe Trompete, soweit noch klarer. In diesem doch irgendwie plumpen Farbrahmen biegt und krümmt sich die Performerin nun während einer knappen Stunde durch verschiedene «Identitäten und Stereotypen der Black Culture», die in ihrem Facettenreichtum letztlich irgendwie untief wirken. Dana Michel möchte ihre Performance an «Orte der Gefahr und Verletzlichkeit» bringen. Ihr krampfhaftes Gebaren ist tatsächlich schmerzhaft anzusehen, so dass man erleichtert zur Kenntnis nimmt, dass sich Michel im plötzlich grün ausgeleuchteten Raum (Karin Gauthier) sichtlich entspannen kann. Ihre Performance ist eigentümlich, gewiss. Aber wie rätselhaft ist sie? Und wie «anstrengend, aber geil»? Vielleicht ist sie auch bloss eine Dosis zu sehr Kunst für diesen Marathon.
Macho Dancer
Schleichend macht sich jedenfalls bei mir eine gewisse Erschöpfung breit. Nicht zuletzt, weil es mir zwischen den Stücken nie zum Essen reicht. Schnell Wasser trinken und Klo müssen reichen. Weiter gehts jetzt zur Tanzperformance «Macho Dancer». Auf einer Catwalk-Bühne im Rossstall setzt sich die Philippina Eisa Jocson in Cowboystiefeln und Camo-Hotpants zu Hardrockmusik «sexuelle Tabus hinterfragend mit den Zweideutigkeiten der Verführung jenseits von klassischen Geschlechterrollen» auseinander. Heisst: Jocson scheint, trotz ihrem androgynen Gesicht, eindeutig eine Frau zu sein. Durch ihre Hotpants aber zeichnet sich in einer pistolenartigen Überdeutlichkeit ein derart übermächtiger Halbständer ab, dass man diese Tatsache erstmal in Frage stellen muss.

Dabei geht es nicht um das kognitive Erfassen der Situation. Das blosse Bild überfordert. Und nach ihrem machoiden Balztanz mit viel Motorsägeaufziehgestik kniet Jocson sich langsam runter zur überforderten vorderen Zuschauerreihe und klebt lasziv ihren weissen Kaugummi an den Bühnenrand, bevor sie endgültig den Blick auf ihre Brüste freigibt. Ja, da hocken wir jetzt und starren ungläublig, ein Strip im heiterhellen Theater. Glücklicherweise lässt uns Jocson ab und an Zeit zum Durchatmen. Mittlerweile steht sie wie eine Säule am Bühnenrand. Ihre langer, schwarzer Haarschopf verdeckt ihr Gesicht ganz, ihre Brüste teilweise, und die Schweissperlen tropfen durchs Scheinwerferlicht auf den Bühnenboden. Ein starkes Bild, sinniere ich noch, als ich plötzlich die Scheinwerfer unter der Bühne bemerke. Mittlerweile strahlen die nämlich so hell, dass sie das Publikum komplett ausleuchten. Jocson ist an der Reihe. Sie steigt von der Bühne runter und schreitet ruhig auf uns zu. Jetzt sind wir dran, eine nach dem anderen. Ich bin wieder hellwach.
Fazit
Das Fazit des Abends ist schnell erzählt. Das Theaterfestival Basel hat gestern ein Programm geboten, das nicht nur in seiner allgemeinen Dramaturgie und ausgewogenen Gewichtung seine Läufer gut über die Runden trug. Jede der fünf Produktionen war absolut sehenswert. Dass dabei die Formkurve Wellen schlägt, liegt auf der Hand. Und ganz zum Schluss sei noch erwähnt: Seinen Tag mit Kunst und Theater zu überfüllen, das sollte man sich ab und an genehmigen.
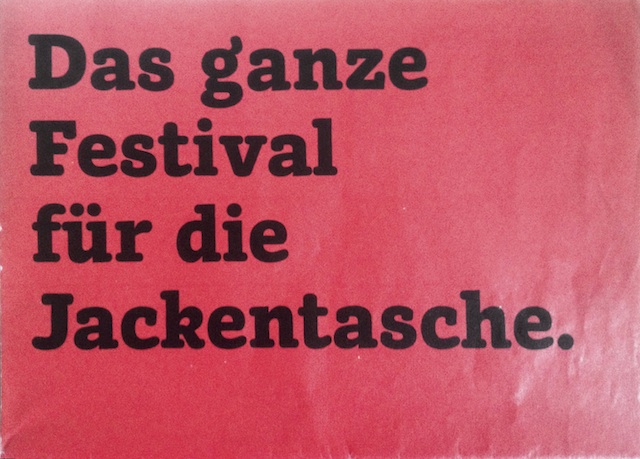
Kleiner Scherz.
