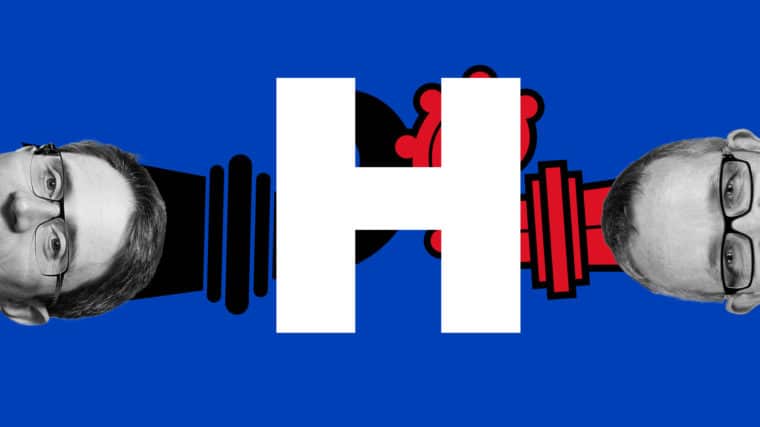Sie blickten sich zwischendurch lächelnd in die Augen, bekräftigten mehrfach die gegenseitige Wertschätzung. Kein Zweifel: Die Gesundheitsdirektoren Thomas Weber (SVP) und Lukas Engelberger (CVP) sind für immer beste Freunde. Zumindest so weit es Freunde in der Spitzenpolitik geben kann.
Man habe auf Augenhöhe verhandelt, ohne Misstrauen, mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen, sagte Engelberger, als er die Pläne einer gemeinsamen Spitalgruppe beider Basel am Montag in Münchenstein vorstellte. Die Inszenierung der gegenseitigen Zuneigung hatte handfeste Gründe. Was Engelberger und Weber sagen wollten: Die Verhandlungen zwischen den beiden Kantonen verliefen deutlich harmonischer als beim Unideal, das Resultat fällt ausgewogener aus.
Die Stadt dominiert die Gruppe
Die Pläne sehen vor, gemeinsame Spitallisten zu führen und Kantonsspital und Unispital unter einem Dach zu vereinen. Basel-Stadt soll rund 70 Prozent Anteile an der neuen Aktiengesellschaft erhalten, Basel-Landschaft 30. Die genaue Verteilung der Anteile hängt vom Wert der Spitäler zum Zeitpunkt der Fusion ab.
Pro Aktie gibt es eine Stimme, was also heissen würde, dass Basel-Stadt die neue Spitalgruppe dominiert. Allerdings wurden Klauseln eingebaut, die den Baselbietern gewichtige Mitbestimmungsmöglichkeiten geben. So braucht es die Zustimmung beider Partner bei wichtigen strategischen Themen, etwa der Schliessung von Spitalstandorten. Diese Standorte sollen künftig Basel, Liestal, Laufen und Bruderholz sein. Zudem kann Baselland mit Zukäufen den Basler Anteil an der Spitalgruppe auf 50 Prozent verringern.
Volksabstimmung ungewiss
Nach Abschluss der Fusion können weitere Akteure Anteile an der neuen Spitalgruppe übernehmen – solange 70 Prozent der Aktien bei den beiden Kantonen bleiben. Die Idee dabei ist vor allem, dereinst Spitäler im Fricktal und im Dorneck einzubeziehen und so einen gemeinsamen Spitalverbund Nordwestschweiz zu schaffen.
So weit die Eckwerte der geplanten Fusion, zu der sich nun alle möglichen Kreise äussern können. Verläuft für Weber und Engelberger alles nach Plan, könnten die Spitäler 2020 mit der Vereinigung beginnen, 2026 soll diese vollzogen sein. Unklar ist zum heutigen Zeitpunkt, ob das Volk in den beiden Basel das Jawort geben muss, das hängt vom Willen der beiden Parlamente ab.
Zu wünschen wäre eine Volksabstimmung, denn die Spitalgruppe weist einige eklatante Mängel auf:
Der Prämienzahler ist der Dumme
War zu Beginn der Verhandlungen vor zwei Jahren noch die Rede davon, die neue Spitalgruppe würde die Krankenkassenprämien senken, verloren Weber und Engelberger heute kein Wort mehr darüber. Zur Erinnerung: Die hohen Prämien stehen zuoberst auf dem Sorgenbarometer der Basler Bevölkerung.
Die Gesundheitsdirektoren schwiegen aus guten Gründen. Verwaltungsinternen Schätzungen zufolge werden die bereits rekordhohen Prämien als Folge der Fusion weiter steigen. Denn die beiden Kantone wollen den ambulanten Bereich stärken, also all jene Behandlungen, für die keine Übernachtung nötig ist. Und für diese kommen vollständig die Krankenkassen auf. Den stationären Bereich, der etwa auf dem Bruderholz zurückgebaut wird, finanzieren die beiden Kanton zu etwas mehr als der Hälfte.
Defizitäre Tagesklinik
Die Sparziele von zehn Millionen Franken pro Kanton und Jahr werden also an anderer Stelle, bei den Bürgern, wieder eingetrieben. Der Basler Gesundheitsökonom Stefan Felder hält entsprechend wenig von der geplanten Spitalgruppe: «Die Verlagerung in den ambulanten Bereich schont zwar die Kantonskasse, geht aber zulasten der Prämienzahler.»
Zumal die geplante Tagesklinik auf dem Bruderholz selbst nach den optimistischen internen Prognosen nur Defizite einfahren wird – also ein Angebot ohne kostendeckende Nachfrage sein wird.
Am Festhalten an der Bruderholz-Klinik zeigt sich das grundlegende Problem dieser Fusion. Zuerst baut man sich gemeinsam ein schönes Haus, möbliert es teurer – und schaut dann, ob es eine Nummer kleiner nicht auch getan hätte.
Zwar legen die beiden Kantone auch den Bereich Gesundheitsvorsorge zusammen, also die Steuerung aller medizinischen Leistungen, doch damit beschäftigt man sich erst, wenn die neue Spitalstruktur fertig gebaut ist. Die politischen Hürden, dannzumal einen Zulassungsstopp teurer Spezialärzte zu verhängen, Leistungen zu kürzen oder Spitäler runterzufahren, sind gross.
Der Prämienzahler: ein Player ohne Lobby
Die Interessenkonflikte sind gravierend bei den beiden Gesundheitsdirektoren. Als Eigner der neuen Spitäler haben sie ein Interesse an möglichst profitablen Spitälern, die möglichst viele Patienten anlocken. Als Vertreter der Bevölkerung müssten sie dagegen die Spitäler eher zurückbinden, um die Krankenkassenprämien zu senken. Doch der Prämienzahler ist der einzige Player im Gesundheitsmarkt ohne Lobby. Entsprechend werden seine Interessen auch in der Planung der Spitalgruppe beider Basel hintan gestellt.
Stefan Felder, Professor an der Uni Basel, hält die Fusion hinsichtlich einer Kostenreduktion für nutzlos:
«Die Probleme mit den wachsenden Gesundheitskosten werden damit nicht behoben. Man hat die Gelegenheit nicht genutzt, die Strukturen zu bereinigen. Die Tagesklinik auf dem Bruderholz ist unnötig, auf dieses Angebot hat niemand gewartet. Wir haben in Basel grosse Überkapazitäten: Die Hospitalisierungsrate ist die höchste der Schweiz, jeder zweite Hospitalisierte wird im selben Jahr ein zweites Mal im Spital behandelt. Das ist einzigartig und problematisch.»
Felder lehnt die Fusion aus einem weiteren Grund ab: Sie beseitigt die Konkurrenz. Kantonsspital und Unispital dominieren schon heute den Markt, kämpfen aber immerhin gegeneinander um Patienten. Der Marktanteil der neuen Spitalgruppe liegt in den beiden Basel bei 75 Prozent – für Felder problematisch hoch: «Es gibt genügend Untersuchungen, die zeigen, dass so eine Dominanz schlecht ist für die Qualität der Versorgung, und dass sie nicht für günstige Preise sorgt.»
Die ersten politischen Reaktionen zur geplanten Spitalgruppe fallen gleichwohl zumeist positiv aus. Weder SVP, LDP oder CVP ist der Prämienzahler eine Erwähnung wert.
Leise Kritik bringt das Grüne Bündnis vor:
Die Frage nach bezahlbaren Krankenkassenprämien wird mit der vorliegenden Spitalfusion nicht beantwortet.
Auch die SP bleibt eher verhalten:
Eine gemeinsame Spitalgruppe macht nur Sinn, wenn sie für die Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt und des Kantons Baselland einen Mehrwert bringt. Ein solcher ist in der vorliegenden Vorlage noch zu wenig ersichtlich. So sind etwa die Auswirkungen auf die Prämienbelastung unklar.
Die FDP hofft, dass mit der neuen Spitalgruppe die Prämienbelastung sinkt:
«Angesichts jährlich steigender Krankenkassenprämien und zur Sicherstellung der hohen Qualität der universitären Kliniken ist es für die FDP von zentraler Bedeutung, dass die Zusammenarbeit über die Kantonsgrenze hinweg gesucht wird.»
Der Prämienzahler ist nicht der einzige Benachteiligte dieser Fusion. Das meint jedenfalls SP-Finanzguru Kaspar Sutter. Der Grossrat legt auf seinem Blog dar, wo das Baselbiet einmal mehr auf Kosten der Stadt profitiert.