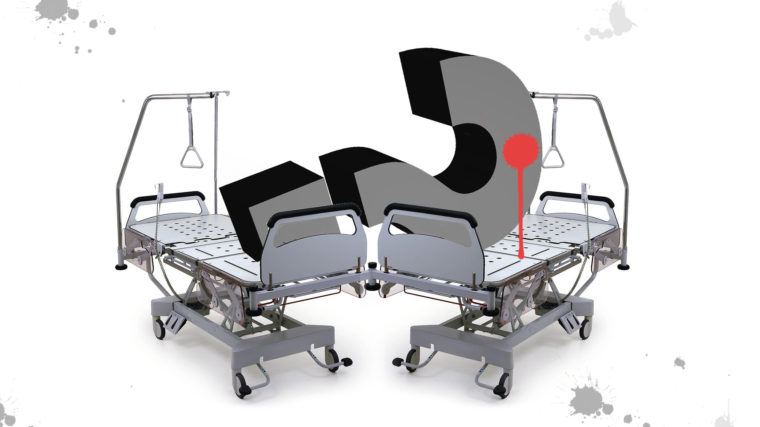Wenn bald die nächste Erhöhung der Krankenkassenprämien bekannt gegeben wird, werden die Gesundheitspolitiker mit den Achseln zucken. Man hat sich daran gewöhnt, dass die Prämien Jahr für Jahr steigen. Mal vier, mal fünf Prozent – sicher aber wird es teuer. Die Gründe dafür sind vielfältig, die Probleme zu lösen, scheint zu kompliziert.
In Basel-Stadt, wo die Prämien schweizweit immer noch am höchsten sind, spricht der Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger momentan am liebsten über ein Projekt, das die Gesundheitskosten langfristig dämpfen soll: die Fusion von Unispital und Kantonsspital Baselland.
Dass die Prämienzahler tatsächlich weniger zahlen, wenn die Spitäler fusionieren, ist unwahrscheinlich. Die Basler SP sprach sich deshalb letzte Woche gegen eine Fusion aus. Insbesondere ist die Partei «vom Nutzen der Fusion nicht überzeugt».
Immer mehr Patienten
Ein Punkt, den das Projekt ausklammert, sind die Privatspitäler. SP-Grossrat Kaspar Sutter sieht darin ein Problem: «Die Absicht, die Kantonsspitäler zu konzentrieren, nützt wenig, wenn gleichzeitig Privatspitäler ihr Angebot massiv ausbauen und dort die Patientenzahlen steigen.»
Ein Blick auf die Patientenzahlen zeigt: Bei den Privatspitälern ist das Wachstum in den letzten Jahren gar grösser als beim Unispital.
Grob gesagt: Wenn die Zahl der Patienten zunimmt, dann steigen auch die Kosten. Ein Grund, weshalb sich immer mehr Patienten in der Stadt behandeln lassen, ist die Einführung der Patientenfreizügigkeit 2014. Auch Verlegungen von Abteilungen – wie der Frauenklinik vom Bruderholz ins Bethesda Spital – sind ein weiterer Grund für mehr Patienten.
Nun wollen die Gesundheitsdirektoren mit der Spitalfusion auch eine gemeinsame Spitalliste für Baselland und Basel-Stadt einführen.
Via Spitallisten, die derzeit noch separat geführt werden, steuern die Kantone, welche stationären Leistungen Spitäler anbieten sollen und welche nicht. Nur wer einen Leistungsauftrag vom Kanton erhält, bekommt für stationäre Behandlungen Geld vom Kanton. Für ambulante Behandlungen haben die Kantone hingegen kaum Steuerungsmöglichkeit.
Wann werden Leistungen gestrichen?
Wenn die Spitalliste gemeinsam mit Baselland geführt wird, werde das Instrument gestärkt, sagt Sutter. Es wäre dann eher möglich, «das Kostenwachstum – auch bei den Privatspitälern – zu dämpfen».
Konkret heisst das: 2020 oder 2021 könnten die Gesundheitsdirektoren von Stadt und Land zusammensitzen und gemeinsam entscheiden: Diese Abteilung braucht es nicht mehr, dort können wir einen Leistungsauftrag streichen.
Das würde Kosten einsparen – beim Kanton und auch beim Prämienzahler. Ob das allerdings so passieren wird, ist fraglich. Engelberger will sich auf Anfrage nicht festlegen. Er schreibt, eine Verknappung des Angebots sei «keine nachhaltige Lösung», da die Patienten so nur in andere Kantone abwandern würden.
Und selbst wenn gestrichen würde, hätte der Prämienzahler davon erst einmal nichts. Denn die Spitäler – ob öffentlich oder privat – könnten die Streichung auf mehrere Jahre hinausschieben, indem sie einen Rekurs beim Bundesverwaltungsgericht einreichen. Kurz: Wer auf der Spitalliste steht, kommt so schnell nicht wieder runter.
Konkurrenz zwischen Öffentlichen und Privaten
Stephan Bachmann von der Vereinigung der Basler Privatspitäler findet, wenn die Spitäler dereinst fusionierten, müssten die Leistungen zuerst bei den Öffentlichen gestrichen werden. «Die privaten Spitäler behandeln tendenziell günstiger als die öffentlichen.» So gebe es insbesondere bei den öffentlichen Spitälern, die in Basel-Stadt und Baselland 75 Prozent Marktanteil haben «Luft nach oben», um zu sparen.
Der Gesundheitsökonom der Universität Basel, Stefan Felder, äussert ein ähnliches Argument. Privatspitäler sollten nicht marginalisiert werden, denn Monopolstellungen, wie es ein Marktanteil von 75 Prozent für die öffentlichen Spitäler de facto wäre, würden zu höheren Kosten und niedriger Qualität führen. Das zeigten verschiedene Studien. «Konkurrenz unter den Spitälern kommt deshalb letztendlich auch den Patienten und Prämienzahlern zugute», so Felder.
Der Forscher ortet das Problem des Kostenwachstums bei der hohen Hospitalisierungsrate und zu vielen Überweisungen. «Das jetzige System bietet keinen Anreiz für weniger Überweisungen und stationäre Behandlungen.»
Wo SP-Politiker Sutter kritisiert, die Regierung müsse sich auch dem Wachstum der Privatspitäler widmen, plädiert Felder für ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen privaten und öffentlichen Spitälern sowie ein anderes Vergütungssystem. In einem sind sich die beiden aber einig: Die Fusion klammert das Wesentliche aus; nämlich das Portemonnaie des Prämienzahlers.