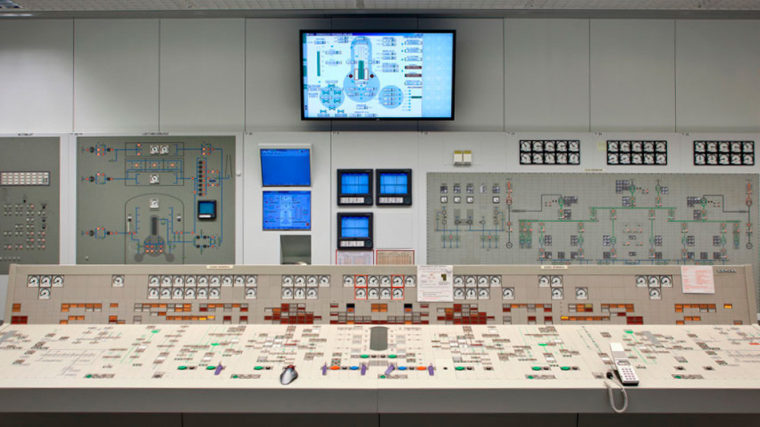Schweizer Atomkontrolleure pflegen zu enge Beziehungen mit den AKW-Betreibern. Jetzt handelt der Bundesrat: Neue Köpfe sollen Vertrauen schaffen.
Im Frühjahr musste Peter Hufschmied, Präsident des Aufsichtsrats des in Brugg domizilierten Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (Ensi), von seinem Amt zurücktreten. Dies nachdem Zweifel an Hufschmieds Unabhängigkeit laut geworden waren. Der vom Bundesrat vor drei Jahren zum obersten Verantwortlichen für die Schweizer Atomaufsicht gewählte Ingenieur pflegte privat geschäftliche Beziehungen zu den Bernischen Kraftwerken (BKW), die das AKW Mühleberg betreiben. Was bei seiner Wahl noch kein Problem war, wurde nach Fukushima plötzlich eines. Denn die Überprüfung der Sicherheit des alten, von einer möglichen Überschwemmung bedrohten BKW-Reaktors war jetzt plötzlich eine der Hauptaufgaben des Ensi, das Hufschmied beaufsichtigte.
Ende Oktober forderte die neue Sensibilität des Ensi in Sachen Unabhängigkeit ein zweites Opfer: Auch Horst-Michael Prasser, Professor für Kernenergiesysteme an der ETH Zürich und ebenfalls Ensi-Aufsichtsratsmitglied, gab seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur für das Lenkungsgremium bekannt, das der Bundesrat bis Ende Monat neu wählen will. Prasser kam damit seiner Abwahl zuvor. Denn als Inhaber des von den AKW bezahlten ETH-Atomtechnik-Lehrstuhles genügt er den inzwischen strenger formulierten Kriterien für Ensi-Aufsichtsratsmitglieder noch weniger als Hufschmied.
Hufschmied und Prasser sind damit die ersten Opfer einer vor Fukushima stets ungehört verhallten Kritik an der Atomaufsicht. AKW-Kritiker werfen der Kontrollbehörde schon seit Jahren mangelnde Unabhängigkeit vor. Seit dem Bau der fünf Schweizer Atomreaktoren pflegten die für die Sicherheit der Schweizer Atomanlagen verantwortlichen Bundesbeamten über all die Jahre immer ein enges, wenig kritisches Verhältnis zu den AKW-Betreibern, die sie kontrollierten.
In der kleinen Schweizer Atomgemeinde kennen sich die Akteure beider Seiten bestens. Und unter dem Druck einer zunehmend AKW-kritischen Öffentlichkeit entstand eine Art Korpsgeist, der Kontrolleure und Kontrollierte verband. Dass die meisten der Inspektoren ursprünglich selber aus der Branche stammten und der Atomtechnologie deshalb grundsätzlich positiv gegenüberstanden, trug dazu bei.
Die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK), wie die Behörde bis 2008 hiess, war deshalb stets bemüht, bei Pannen und Zwischenfällen jeweils sofort die Öffentlichkeit zu beruhigen. Es bestehe keine Gefahr für Mensch und Umwelt und man habe alles im Griff, so die Standardinformation aus der damals noch im Bundesamt für Energie und am traditionellen Atomkraftstandort Würenlingen angesiedelten Atomaufsicht.
Offene Fragen und mögliche Lücken der AKW-Sicherheit wurden nie öffentlich kommuniziert, sondern hinter verschlossenen Türen unter Experten diskutiert. Das war auch nach Tschernobyl so, als man die Überlegenheit der westlichen Technologie gegenüber der sowjetischen bemühte. Erst Fukushima, wo technisch vergleichbare Reaktoren wie in der Schweiz ausser Kontrolle gerieten, hat diese Bunkermentalität erschüttert. Dabei kam die Katastrophe in Japan für die hiesige Atomaufsicht und die AKW-Betreiber im dümmsten Moment: Gesuche der Stromkonzerne Axpo, Alpiq und BKW für neue AKW waren auf gutem Weg, und auch in der Schweiz verkündete die Atomlobby eine Renaissance ihrer Technologie. Die punkto Ressourcen im Vergleich zu den internationalen Atomkonzernen schon immer überforderten Schweizer Kontrolleure begleiteten die Neubaupläne mit Wohlwollen. Die öffentliche Meinung zu den Neubauprojekten interessierte die unpolitischen Sicherheitsinspektoren nicht.
Probleme weggeschwiegen
Organisatorisch hatte man sie inzwischen aus dem Bundesamt für Energie, das bis anhin gleichzeitig für Kontrolle wie für Bewilligung von Atomanlagen zuständig war, ausgegliedert, verselbstständigt und auch örtlich vom Atomstandort Würenlingen ins nahe Brugg verlegt. Mit der Neuorganisation wollte man aus der HSK eine organisatorisch unabhängigere Fachagentur machen.
Personell blieb beim Wechsel von der HSK zum Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat, wie die Behörde seither heisst, aber alles beim Alten. Ein Kulturwechsel fand nicht statt. Informiert wurde wie schon immer. Offene Fragen etwa zur Erdbebensicherheit der bestehenden und der geplanten Werke hielt man unter dem Deckel, stets im Bemühen, ja nicht die politisch umstrittenen Pläne der AKW-Bauer zu erschweren.
Im Zuge der Neuorganisation der Atomaufsicht hatten die AKW-Betreiber auch erreicht, dass die unabhängigere und mutigere Expertenkommission des Bundes für die Atomsicherheit, die Kommission für die Sicherheit der Atomanlagen (KSA), personell und finanziell abgewertet wurde. Um ein Haar wäre sie dem Wunsch der Atomkraftlobby entsprechend ganz abgeschafft worden. Denn im Unterschied zu den beamteten HSK-Kontrolleuren hatte die KSA unter ihrem atomkritischen Präsidenten Walter Wildi zum Ärger der AKW-Betreiber immer wieder auf ungelöste Fragen und kritische Punkte der Sicherheit hingewiesen.
Inzwischen hat der Wind gedreht. Fukushima hat nicht nur die AKW-Neubaupläne vom Tisch gewischt, sondern auch beim Ensi zu einem Einsehen geführt. In Brugg hat man gemerkt, dass die Atomaufsicht ein Vertrauensproblem hat. Das zeigt neben den zwei Rücktritten aus dem Ensi-Aufsichtsrat auch die Einsetzung einer internationalen Begleitkommission, die künftig periodisch die Arbeit der Kontrolleure in Brugg überprüfen soll. Dass in diesem Gremium auch ein AKW-kritischer Experte des Ökoinstituts in Darmstadt sitzt, ist zu begrüssen. Die gleichzeitige Entsendung des langjährigen, nie durch grossen Mut aufgefallenen, vorzeitig pensionierten Ex-HSK-Direktors Ulrich Schmocker in die Kommission dämpft die Erwartungen allerdings gleich wieder.
Vertrauensproblem ist erkannt
Wie schwer dem Ensi ein Kurswechsel hin zu mehr Unabhängigkeit noch immer fällt, zeigt die Art und Weise, wie es kürzlich seine Schlüsse aus Fukushima der Öffentlichkeit präsentierte. Zwar sei man noch dabei, verschiedene Fragen genauer zu prüfen und für eine abschliessende Beurteilung sei es noch zu früh, teilte man den Medien mit. Um dann in altbekannter Manier festzuhalten, dass jetzt schon sicher sei, dass der Betrieb der Schweizer AKW keine Gefahr darstelle.
Derzeit steht die Neuwahl des Ensi-Aufsichtsrats durch den Bundesrat an. Wolle man die Unabhängigkeit des Ensi tatsächlich vergrössern und das Vertrauen der Öffentlichkeit gewinnen, sollten im Aufsichtsrat auch atomkritische, neutrale Fachleute den Kurs des Ensi mitbestimmen, fordern Umweltschützer und AKW-Kritiker. Denn auch ohne neue AKW brauche die Schweiz eine strenge Atomaufsicht: für den sicheren Betrieb der bestehenden Reaktoren und die sorgfältige Suche nach Atommüllendlagern.
Artikelgeschichte
Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 18/11/11