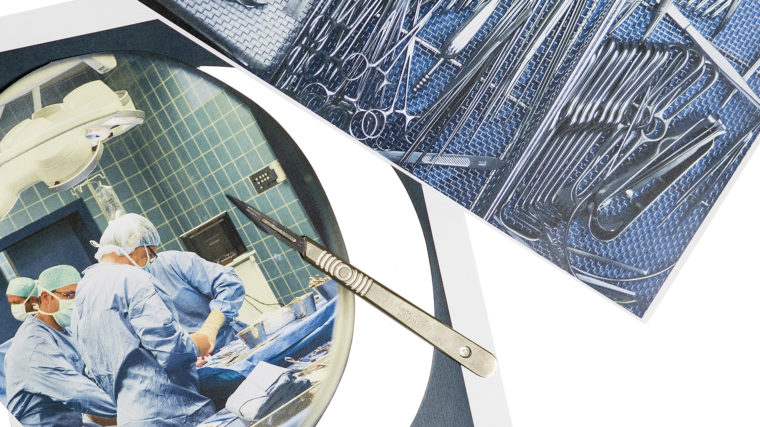Mit jeder Reform wird uns versprochen, man habe nun die Krankenkassenprämien im Griff. Das Gegenteil ist wahr.
Der Preisüberwacher ist so etwas wie ein Spielverderber. In regelmässigen Abständen kritisiert Stefan Meierhans, die Spitäler kassierten zu viel. Auch in der Region Basel: Hier ist es allen voran das Kantonsspital Baselland mit seinen drei Standorten Liestal, Bruderholz und Laufen. Dieses sei 13 Prozent teurer als vergleichbare Spitäler. Aber auch das Unispital Basel kassiere 10 Prozent zu viel.
Doch Spitäler, aber auch Kantone, ja selbst manche Krankenkassen nehmen seine Empfehlungen nicht sonderlich ernst. Im vertraulichen Gespräch spotten sie auch schon einmal über die angeblich völlig unrealistischen Forderungen des Preisüberwachers. Doch der Spielverderber trifft tatsächlich einen wunden Punkt.
Seit 1996 haben sich die Krankenkassenprämien mehr als verdoppelt – bei nur 11,2 Prozent Teuerung.
Denn auch wenn der dieses Jahr prognostizierte Prämienanstieg mit durchschnittlich gut zwei Prozent vergleichsweise moderat ausfallen dürfte, summiert sich der stetige Anstieg: Seit der Einführung des neuen Krankenversicherungsgesetzes im Jahr 1996 haben sich die Prämien mehr als verdoppelt. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum stieg die Teuerung lediglich um 11,2 Prozent. Die Kosten sind auf über 26 Milliarden Franken geklettert.
Noch schlimmer ergeht es den Versicherten im Kanton Basel-Stadt. Hier ist die durchschnittliche Vergleichsprämie bereits bei 500 Franken angekommen.
Das trifft zuallererst den Mittelstand. Denn untere Einkommen profitieren von Prämienverbilligungen, die ein Gesundheitsökonom einmal als «Opium fürs Volk» bezeichnet hat. Gutverdiener stecken eine teurere Grundversicherung, die nur einen Bruchteil ihres Budgets frisst, locker weg.
Ein Ende des Anstiegs ist noch immer nicht in Sicht. Selbst Bundesrat Alain Berset warnt in einem Strategiepapier «Gesundheit 2020» davor, dass die Kosten in der Grundversicherung weiter steigen werden. Der medizinische Fortschritt, die immer älter werdende Gesellschaft und die mit dem Wohlstand gestiegenen Nachfrage nennt der Bundesrat als Hauptgründe. Neue Kostentreiber würden dazukommen wie personalisierte Medizin oder neue Medikamente für seltene Krankheiten, so Berset. Der Druck auf die Prämienverbilligungen werde zunehmen, «womit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass radikalere Massnahmen – etwa Einschränkungen des Grundleistungskatalogs (…) – mehrheitsfähig werden». Damit droht eine medizinische Zweiklassengesellschaft.
Teurer – ob stationär oder ambulant
Hauptverantwortlich für diesen Kostenanstieg sind die Spitäler. Die Hälfte des Anstiegs bei der Grundversicherung in den letzten zehn Jahren geht auf ihr Konto, und zwar für stationäre und ambulante Behandlungen.
Besonders gravierend dabei ist die boomende ambulante Behandlung, denn dies schlägt sich zu hundert Prozent auf die Prämien nieder. An stationären Aufenthalten hingegen beteiligen sich die Kantone mit gut der Hälfte der Kosten. «Die Arztkosten haben wir inzwischen relativ gut im Griff, nicht aber die Kosten ambulanter Spitalbehandlung», sagt der Comparis-Krankenkassenspezialist Felix Schneuwly.
Wie sich das Wachstum der ambulanten Behandlung zusammensetzt, können nicht einmal Gesundheitsforscher schlüssig erklären. Reto Schleiniger, Professor an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, untersuchte in einer Studie, ob sich das Phänomen mit einer Verschiebung erklären lässt – also mit Behandlungen, die Spitäler immer mehr ambulant statt stationär vornehmen.
Doch damit allein lässt sich der Boom nicht erklären. Vielmehr ist das Wachstum vor allem auf das grössere Angebot der Spitäler zurückzuführen: medizinischer Fortschritt, der neue Behandlungen möglich macht, aber auch ausgebaute ambulante Angebote, die wiederum mehr Patienten anlocken. Allen Unklarheiten zum Trotz lässt sich das Phänomen letztlich auf die einfache Formel bringen: Mehr Behandlungen sorgen für steigende Kosten.
Chirurgen warnen vor zu viel Operationen
Bereits schlagen sogar Chirurgen Alarm und warnen vor unnötigen Operationen. Denn inzwischen wird jeder zweite Spitalpatient operiert. Das sind rund 700 000 Operationen pro Jahr.
In Deutschland, das lange vor der Schweiz Fallpauschalen einführte, stieg die Zahl der Operationen seither um 25 Prozent, ohne dass die Bevölkerung kränker oder entscheidend älter geworden wäre. Im Zweifel lieber einen Blinddarm mehr operieren oder eine Prothese mehr einsetzen, weil es dafür Geld gibt, heisst die Devise.
Die gleiche Entwicklung droht auch in der Schweiz. Manche Chirurgen warnen vor den Nebenwirkungen der Fallpauschalen. Weil die Spitäler pro Fall weniger Geld erhielten, hätten sie die Ärzte aufgefordert, mehr zu operieren. Ähnlich argumentiert die Schweizerische Gesellschaft für Chirurgie: Die Fallpauschalen würden den Kostendruck so stark erhöhen, dass viele Spitalverantwortliche ganz einfach versuchten, mehr Fälle zu generieren.
Leere Pauschalversprechen
Seit knapp zwei Jahren rechnen die Spitäler schweizweit mit Fallpauschalen nach deutschem Vorbild ab. Im Vorfeld versprachen sich Politikerinnen und Politiker viel von diesem Systemwechsel. Patienten, die ihr Spital frei wählen könnten, sollten für mehr Wettbewerb zwischen den Spitälern sorgen. Und dank der Fallpauschalen sollte es für Patienten auch möglich sein, nicht nur die Kosten, sondern auch die Qualität der Spitäler beurteilen zu können. Doch von diesen Versprechen ist nicht mehr viel übrig.
Der Wettbewerb zwischen den Spitälern hält sich in engen Grenzen; noch immer entscheiden sich viele Patienten für das nächstbeste Spital. Deshalb bleibt es weitgehend undurchschaubar, wie gut ein Spital wirklich arbeitet – obwohl die dazu nötigen Daten vorhanden wären. Das Bundesamt für Gesundheit veröffentlicht zwar, wie viele Eingriffe ein Spital vornimmt sowie die Sterblichkeitsrate. Daraus können aber nur Experten die Qualität der Behandlung tatsächlich ableiten.
Was im Gesundheitswesen in der Theorie funktionieren könnte, scheitert bei der praktischen Umsetzung. Noch immer zahlen wir nach Schätzung von Experten rund einen Fünftel der Krankenkassenprämie allein für Ineffizienz. Kommt dazu, dass bei der konkreten Umsetzung sofort alle Beteiligten mitmischeln: Ärzte, Spitäler, Kantone, Krankenkassen.
Beispiel freie Spitalwahl: Nicht einmal zwischen den beiden Basel funktioniert diese richtig. Baselbieterinnen und Baselbieter, die sich in einem städtischen Spital behandeln lassen wollen, müssen zuerst abklären, ob die Behandlung auf der Spitalliste des Kantons Baselland steht. Ist dies nicht der Fall, laufen die Patienten im schlimmsten Fall Gefahr, auf Kosten von mehreren Tausend Franken sitzen zu bleiben.
Grund dafür sind unterschiedliche Grundtarife der Spitäler. Diese sogenannte Baserate dient als Berechnungsgrundlage für die Spitalrechnungen: Jede Diagnose – von der Blinddarmentzündung bis zum Herzinfarkt – hat ein eigenes sogenanntes Kostengewicht. Dieses wird mit der Baserate multipliziert. Die Baserate des Universitätsspitals Basel zum Beispiel beträgt 10 700 Franken. Doch der Kanton Baselland bezahlt an eine ausserkantonale Behandlung nur eine solche von 10 106 Franken. Auf der Differenz bleiben die Grundversicherten sitzen. Der Kanton Baselland zahlt an die ausserkantonale Behandlung gar noch weniger als an eine Behandlung im eigenen Kantonsspital.
Ursprünglich hatten die Regierungen beider Basel vereinbart, dass ab 2014 alle Hindernisse abgebaut werden und die volle Freizügigkeit kommen soll. Doch diese steht wieder auf der Kippe. Im Baselbiet fürchtet man sich davor, zu viele Patienten an die Stadt zu verlieren. Versuche, die Kosten endlich auf politischer Ebene in den Griff zu bekommen, scheitern regelmässig. Ein Spital zu schliessen kommt für einen Gesundheitsdirektor einem politischen Selbstmord gleich. Gewagt und überlebt hat dies ausser der Zürcher Gesundheitsdirektorin Verena Diener wohl keiner.
Linke und Bürgerliche wehren sich meist gemeinsam gegen allzu starken Kostendruck.
Viele Regierungsräte setzten denn auch grosse Hoffnungen auf die Fallpauschalen. Dank Wettbewerbsdruck sollten ineffiziente Abteilungen oder gar Spitäler geschlossen werden können. Daran trüge keiner mehr persönlich Schuld. Es wäre dann einfach der Wettbewerb, der diktiert. Es gibt kaum einen Bereich mit so vielen Lobbyisten und Interessensvertretern im Bundesparlament wie im Gesundheitssektor. Während bürgerliche Politiker meist die Interessen der Pharmaindustrie oder der Spitäler vertreten, sind es bei den Linken eher diejenigen der Angestellten im Gesundheitswesen. Sie wehren sich aber meist gemeinsam gegen einen allzu starken Kostendruck. Selbst wenn das Parlament einmal zu einem Minimalkonsens gelangt wie zuletzt bei der Managed-Care-Vorlage, scheitert dieser spätestens in der Volksabstimmung.
Der Basler Gesundheitsdirektor Carlo Conti sieht trotzdem nicht so schwarz: «Ohne die politischen Reformen wären die Kosten noch sehr viel rascher und stärker gestiegen.» Die Krankenkassenprämien seien vor allem deshalb so stark gestiegen, weil mehr Leistungen konsumiert würden. Derweil nimmt die Linke einen nächsten Anlauf für eine Einheitskasse. Auch wenn es dafür viele Argumente geben mag, eine spürbare Kostenentlastung wird die Einheitskasse nicht bringen. Darüber sind sich Gesundheitsökonomen weitgehend einig. Dazu ist der Anteil des Verwaltungsaufwands der Krankenkassen mit fünf Prozent an den Gesamtkosten zu gering. «Die Einheitskasse wird das Problem der steigenden Kosten im Gesundheitswesen genauso wenig lösen, wie das Minarettverbot den religiönen Fundamentalismus verhindert», sagt Comparis-Experte Felix Schneuwly. Hat er recht? Diskutieren Sie mit und stimmen Sie ab zur Frage: «Braucht die Schweiz eine Einheitskasse?».
Artikelgeschichte
Erschienen in der Wochenausgabe der TagesWoche vom 13.09.13