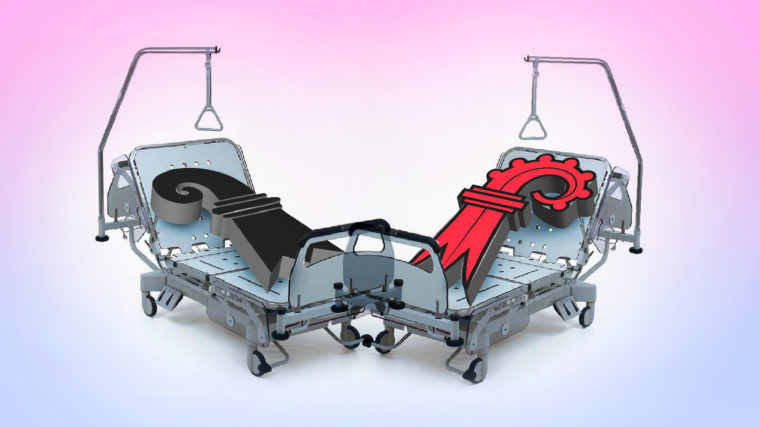Das Baselbieter Stimmvolk hat eben erst ein positives Signal für die geplante Spitalfusion gesendet. Und schon stellen die SP Basel-Stadt und Baselland den Plan der Gesundheitsdirektoren Engelberger und Weber wieder in Frage.
Auslagerungen sind für die SP eine schwierige Sache. An und für sich schlägt das sozialistische Herz dafür, Staatsbetriebe als solche zu belassen: Was dem Staat gehört, das kann man kontrollieren, zum Beispiel wenn es um Arbeitsbedingungen wie Löhne oder Vaterschaftsurlaub geht. Doch die Sozialdemokraten sind eben keine Sozialisten, sondern Sozialdemokraten. Die wollen durchaus auch geschäften. Und dafür, heisst es, soll man Betriebe etwas von der Leine lassen, damit sie sich im Wettbewerb behaupten können.
Das Dilemma mit der Leine – und wie locker man sie lassen soll – zeigte sich im Jahr 2011 bei der Diskussion um die Auslagerung der öffentlichen Spitäler Basel-Stadt in eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Und das Dilemma zeigt sich jetzt wieder bei der Diskussion um die Spitalfusion Basel-Stadt und Baselland.
Seit dem vergangenen Abstimmungssonntag ist die gemeinsame Spitalplanung einen Schritt weiter: Die Baselbieter Stimmbürger haben das Bruderholzspital in seiner heutigen Form verabschiedet. Das ist ein positives Signal an die Gesundheitsdirektoren der beiden Halbkantone, das Projekt einer gemeinsamen Spitalgruppe weiterzutreiben.
Ein langes Ringen steht an
Allerdings zeichnet sich jetzt schon ab: Einfach werden sie es damit nicht haben. Kaum ist die Abstimmung nämlich vorbei, haben die SP Baselland und Basel-Stadt ein gemeinsames Positionspapier veröffentlicht. Darin formulieren die Sozialdemokraten Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit sie die gemeinsame Spitalgruppe mittragen.
Die Bedingungen haben es in sich. In einigen Punkten widersprechen sie diametral dem, was die Gesundheitsdirektoren Lukas Engelberger (CVP) und Thomas Weber (SVP) planen. So fordert die SP:
«Die Spitalgruppe soll in ihrer Rechtsform eine öffentlich-rechtliche Anstalt bleiben.»
Engelberger und Weber schlagen dagegen vor, für die Spitalgruppe eine gemeinnützige Aktiengruppe (AG) zu gründen. Diese geplante Privatisierung geht der SP, wenig überraschend, gegen den Strich. Der Parteipräsident der SP Basel-Stadt, Pascal Pfister, sagt: «Die Parlamente sollen bei wichtigen strategischen Entscheiden mitentscheiden können.» So etwa, wenn es um eine Fusionierung mit weiteren Spitälern oder um Standortentscheide gehe.
Bei einer AG kann der Kanton nur indirekt Einfluss nehmen. Die Regierung kann einen Verwaltungsrat stellen und als Aktionär an der Delegiertenversammlung teilnehmen. Dabei gilt: Je mehr Aktien, desto mehr Gewicht hat die eigene Stimme. Der Kanton will sich aber offenhalten, 30 Prozent der Aktienanteile an Dritte zu verkaufen. Somit hätten plötzlich Private Mitsprache bei den Spitälern. «Dieses Hintertürchen lassen wir der Regierung lieber nicht offen», sagt Pfister.
In der öffentlich-rechtlichen Anstalt, wie sie die SP fordert, hätte die Politik mehr Mitsprache, wie man am Beispiel der öffentlichen Spitäler Basel-Stadt sieht: Hier genehmigt die Regierung die Jahresrechnung und legt sie dem Parlament zur Kenntnisnahme vor.
Am Sinn einer Privatisierung zweifelt die SP aber grundsätzlich, auch aus wirtschaftlicher Überlegung. «Private Spitäler müssen Gewinn machen», sagt Pfister, «da bietet es sich an, mehr Operationen durchzuführen als nötig, um mehr Geld reinzuholen.» Das Resultat: höhere Kosten für die Krankenkassen und die Versicherten.
Zündstoff bietet auch eine weitere Forderung der beiden SP. Eine, die den bereits schwelenden Konflikt zwischen den Halbkantonen weiter anheizen dürfte:
«Beide Kantone sollen das gleiche Eigenkapital einbringen. Sonst sind die Stimmanteile entsprechend zu gewichten.»
Die Regierungen planen, dass Baselland gleich viel Mitspracherecht erhält, obwohl der Kanton nur 28,5 Prozent des Aktienkapitals einschiessen soll, Basel-Stadt aber 71,5 Prozent. Dass diese Aufteilung bei den Städtern nicht nur auf Zustimmung stösst, ist klar. «Wer gleich viel mitbestimmen will, muss auch gleichviel zahlen», sagt dementsprechend der Parteipräsident SP Basel-Stadt. Doch sogar die Baselbieter SP-Landrätin Regula Meschberger sagt: «Wir müssen einen fairen Ausgleich finden.»
Signale aus Zürich und dem Aargau
Es ist kein Zufall, dass die SP gerade jetzt mit ihren Forderungen kommt: Sie wähnt sich im Fahrtwind der Zürcher und Aargauer. Am selben Tag, an dem das Baselbiet das Schicksal des Bruderholzspitals besiegelte, haben sich die Zürcher dagegen ausgesprochen, das Kantonsspital Winterthur und die Psychiatrie Winterthur-Zürcher Unterland zu privatisieren. Dasselbe in Aarau: Dort wollte der Stadtrat Alters- und Pflegeheime in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft umwandeln. Die Stimmbevölkerung wollte das nicht. «Diesen Entscheid aus Zürich nehmen wir als Signal, dass die Bevölkerung hinter der SP steht und keine Privatisierung im Gesundheitsbereich will», sagt Pfister.
Ob die Forderungen der SP richtig sind oder nicht, darüber lässt sich diskutieren. Streiten lässt sich aber auch darüber, ob die Partei den richtigen Zeitpunkt dafür gewählt hat.
«Nein», findet Marc Scherrer (CVP), Mitglied der Gesundheitskommission im Landrat. «Es ist kontraproduktiv, jetzt schon Bedingungen aufzustellen. Wenn wir wollen, dass die Spitalfusion klappt, müssen wir jetzt erstmals offen sein und dann ruhig und überlegt diskutieren.»
Mit «dann» meint Scherrer: nach dem Sommer, wenn die Regierungen beider Basel die Vernehmlassung zum Projekt starten wollen.
Es überrascht nicht, dass der CVP-Mann keine Freude hat an den Forderungen der SP. Schliesslich gehört er selber zur Sorte Privatisierungsturbo: Er hat einen Vorstoss für eine Privatisierung der basellandschaftlichen Spitäler eingereicht (noch hängig). Doch so eng will er es gar nicht sehen: «Von mir aus müssen die Spitäler nicht unbedingt privatisiert werden», sagt er. Er wolle erstmal abwarten, welchen Plan die Regierung vorlege. «Wenn eine öffentlich-rechtliche Anstalt mehr Sinn macht, bin ich auch für eine öffentlich-rechtliche Anstalt zu haben.» Doch jetzt, im Moment, müsse man den Regierungen den nötigen Spielraum lassen, um eine gute Lösung auszuarbeiten.
Will die SP etwa gar keine Fusion?
Dann nimmt Scherrer aber doch noch Stellung, und zwar zu Forderung sechs aus dem Positionspapier der SP:
«Die Arbeitsbedingungen und die Vorsorge der Mitarbeitenden der zukünftigen Spitalgruppe dürfen keinen Leistungsabbau beinhalten, Entlassungen sind zu vermeiden.»
«Diese Forderung schränkt viel zu sehr ein», sagt Scherrer. Es sei doch gerade das Ziel der Fusion, den Betrieb zu optimieren und Überkapazitäten abzubauen. Mit dieser Argumentation wird Scherrer bei der SP allerdings nicht weit kommen. Man erinnere sich an die Diskussion über die Verselbstständigung der öffentlichen Spitäler Basel-Stadt im Jahr 2011.
Damals beschloss der Grosse Rat, die Spitäler auszulagern und sie in eine öffentlich-rechtliche Anstalt umzuwandeln – also das, was die SP jetzt für die Spitalgruppe will. Aber auch wenn die SP dieselbe Rechtsform nun bei der Spitalfusion fordert: Ganz unumstritten ist sie nicht einmal bei den Sozialdemokraten selbst. Im Jahr 2011 unterstützten viele SPler am Ende ein Referendum gegen die Umwandlung der Spitäler in eine öffentlich-rechtliche Anstalt, weil dem Personal schlechtere Anstellungsbedingungen drohten.
Hat die SP bei der Spitalfusion Ähnliches vor?
«Die SP steht grundsätzlich hinter einer Fusion», sagt Pfister, «aber wenn das Ziel eine Privatisierung ist, dann wollen wir sie nicht.»
Noch mehr potenzielle Gegner
Die Soziademokraten sind übrigens nicht die Einzigen mit Bedingungen. Der Laufentaler Stadtpräsident Alex Imhof (CVP) drohte gegenüber der BaZ: Sollte die Regierung das Laufentaler Spital im Zuge der Fusion herunterfahren, wie es geplant ist, werden die Laufentaler die Fusion bekämpfen. Das Laufental stimmte denn auch fast geschlossen gegen die Bruderholzspitalinitiative, anders als der Rest des Kantons.