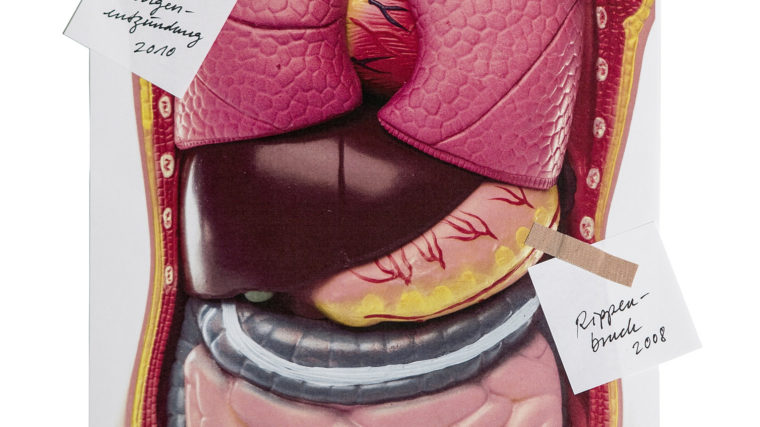Mit digitalen Dossiers liessen sich Kosten sparen. Doch dagegen regt sich Widerstand.
Warum kann das alles nicht wie bei Google funktionieren? Täglich hinterlassen Millionen von Nutzern dem Suchgiganten bereitwillig persönlichste Einzelheiten zu ihrer Person. Diese Daten haben eine Industrie völlig umgekrempelt: Die Werbebranche ist nicht mehr wiederzuerkennen.
Wer seine Produkte verkaufen will, braucht nicht mehr ein Plakat an eine Strassenkreuzung zu hängen, ohne erahnen zu können, wer es sehen wird. Das digitale Äquivalent zum Plakat ist billiger und effizienter. Es wird nur denen gezeigt, die am ehesten kaufen, und nur bezahlt, wenn es wirkt. Ist das eine gute Entwicklung?
Wer für die Werbung ins Portemonnaie greifen muss, antwortet auf diese Frage mit Ja. Viele, die sich hierzulande mit dem Gesundheitssystem beschäftigen, erhoffen sich von mehr Dateneinsicht und Transparenz Ähnliches.
Die Schweiz leistet sich ein ungeheuer teures System. Nur in den USA und Norwegen wird pro Kopf mehr für Gesundheit ausgegeben als in der Schweiz, errechnete die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).
Informationen retten Leben
In der Schweiz sind es rund 5200 Franken pro Kopf. Nur dank einer gesunden Wirtschaft stiegen die Kosten lediglich auf rund elf Prozent des Bruttoinlandproduktes, während das Wachstum in anderen Ländern den unaufhaltsam steigenden Kosten hinterherhinkt.
Einzelheiten darüber, wie Medikamente verschrieben werden, wie Krankheiten behandelt und wie Patienten von Institution zu Institution verschoben werden, könnte Ineffizienz ans Licht bringen, Lösungsansätze erkennbar machen und, so glaubt eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern in der Schweiz, möglicherweise sogar Leben retten. In einem kürzlich veröffentlichten Manifest fordern gut zwei Dutzend Medizinerinnen und Mediziner besseren Zugang zu Gesundheitsdaten.
Am meisten Potenzial sehen Apotheken und Spitäler.
Milo Puhan ist einer der Verfasser des Manifestes. Der Direktor des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin an der Universität Zürich versucht an einem Beispiel zu erklären, was eine grössere Übersicht in der Schweiz bringen könnte. «Es gibt nach fast jeder Operation milde bis schwerwiegende Komplikationen», sagt Puhan. «Werden diese bei einem Hausarzt behandelt, ist der Patientenweg für die Forschung abgeschnitten.» Das sei ärgerlich, denn diese Informationen könnten Behandlungsfehler aufdecken.
Nun ist es nicht so, dass diese Daten nicht vorhanden wären. Die Digitalisierung hat die Menge an Informationen, die über Patienten gespeichert werden, explosionsartig steigen lassen. Diese Entwicklung hat vor dem Schweizer Gesundheitssystem nicht haltgemacht. Der Koordinationsgruppe des Bundes und der Kantone, eHealth Suisse, zufolge setzt sich ein Drittel der Kantone aktiv mit der Digitalisierung auseinander.
Dazu kommt eine schwer zu beziffernde Menge an Arztpraxen, die Behandlungsdaten für sich selbst speichert. Und die Patientinnen und Patienten selbst werden den Rest tun. In den USA wird gemäss der Investorengruppe Kleiner Perkins Caufield & Byers schon in wenigen Jahren jeder Dritte seine Fitness mit einer App auf dem Smartphone verfolgen.
Uneinheitliche Standards
Auch in der Schweiz dürfte diese Art der digitalen Selbstbeobachtung zunehmen. Ärzte könnten wertvolle Informationen erhalten, wenn wir via Smartphone aufzeichnen, wie weit wir am Morgen gejoggt sind oder wie gut wir geschlafen haben. «Werden solche Daten in einer digitalen Patientenakte gespeichert, wäre das «eine interessante Entwicklung für Behandlung und Forschung», sagt Marco Zoller.
Der Arzt ist Mitinitiant der FIRE-Datenbank, dank der die Datenflüsse zwischen Hausärzten und Spitälern verbessert werden sollen. «Wenn ein Patient seine Blutzuckerwerte in einer App erfasst und sie seinem Arzt übermittelt, ist das viel besser, als wenn er das in seinem Diabetes-Büchlein einschreibt.» Es entstünden vollständigere und zuverlässigere Daten.
Selbst dann jedoch wären die Informationen im heutigen System in der Schweiz nicht für alle zugänglich, die mit ihnen arbeiten könnten. Um sie frei verfügbar zu machen, muss erst eine gemeinsame technologische Sprache gefunden werden – eine, die schweizweit verstanden wird, im besten Fall sogar weltweit.
Die Datenstandards sind in der Schweiz nicht einheitlich.
Die Datenstandards sind in der Schweiz, wie fast alles im Gesundheitssystem, nicht einheitlich. Dies nannten alle Ärzte, mit denen die TagesWoche gesprochen hat, als Hauptgrund für die schwierige Umsetzbarkeit der hiesigen eHealth-Pläne. «Die Schweiz wird noch Jahre daran zu beissen haben, dass Daten in verschiedenen Programmen erfasst werden», sagt Marco Zoller.
So wie soziale Netzwerke wie Google oder Facebook nutzlos sind, wenn sie nicht von Freunden gemeinsam benutzt werden, so ist auch das Teilen von Gesundheitsdaten unmöglich, wenn verschiedene Systeme eingesetzt werden, die nicht miteinander kommunizieren. Eine gemeinsame Sprache zu entwickeln sei «die grösste Herausforderung», sagt Heinz Behnd vom Institut für Praxisinformatik.
Rund 20 verschiedene Softwareprogramme würden heute bei Hausärzten eingesetzt, so Behnd. Alle sprechen eine eigene Sprache. Und wie Facebook und Google betreiben auch die Hersteller dieser Programme Kundenbindung, indem sie Daten möglichst in ihren eigenen Netzwerken behalten.
«Ideal wäre ein einziges System, in das Daten eingegeben werden», sagt der Sozial- und Präventivmediziner Milo Puhan. Doch das sei in der Schweiz gegenwärtig «total unrealistisch». Das hiesige System, in dem 26 Kantone schalten und walten, lasse das nicht zu. «Dänemark hat es da einfacher.»
Debatte um Bundesgesetz
Die Dänen werden weltweit um ihr eHealth-System beneidet. Über ein zentrales System können Patientinnen und Patienten auf ihre Krankengeschichte zugreifen, sie Ärzten zugänglich machen, die aus demselben System Rezepte schreiben und digital an Apotheken übermitteln. Den dänischen eHealth-Spezialisten ist es gelungen, den 15 verschiedenen Systemen für Patientenakten eine einheitliche Sprache beizubringen.
Das ist in der Schweiz noch Zukunftsmusik. Am meisten Potenzial in der Digitalisierung sehen Spitalverantwortliche und Apotheker, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes gfs Bern zeigt. Weniger enthusiastisch sind die Hausärztinnen und Hausärzte.
Für den Mediziner Marco Zoller ist das wenig überraschend. In seiner Praxis gehen immer öfter Anfragen von Spitalsachbearbeitern ein, Patientendossiers künftig doch bitte elektronisch zu übermitteln. «Digitale Spitalüberweisungen bedeuten für uns Mehrarbeit. Wir müssten die Daten jeweils doppelt erfassen. Und das macht natürlich kein Arzt. Es fehlen die Anreize.»
Neues Gesetz geplant
Sowohl bessere Anreize wie auch Datenstandards dürften dieses Jahr im Zentrum der Diskussionen in den Gesundheitskommissionen der eidgenössischen Räte stehen. In der soeben gestarteten Session debattiert die ständerätliche Kommission über den Entwurf des Bundesgesetzes über das elektronische Patientendossier (EPDG). Ziel der Vorlage ist die Schaffung einer elektronischen Krankengeschichte, die für Patienten via Internet editierbar und mit den Ärzten ihrer Wahl teilbar sein soll.
Das Gesetz soll 2015 in Kraft treten und den Weg für eine Digitalisierung des Gesundheitswesens im grossen Stil ebnen. Doch auch danach ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, denn das einheitliche System hat auch Gegner.
«Man würde wahrscheinlich Dinge über das Gesundheitssystem lernen, die einigen ans Portemonnaie gingen», sagt Milo Puhan. Kostentreibende Leerläufe würden aufgedeckt sowie Optimierungspotenzial und Sparmöglichkeiten erkannt. Oder wie es Puhan formuliert: «Der Kuchen wird dann unter Umständen ein bisschen kleiner.»
Artikelgeschichte
Erschienen in der Wochenausgabe der TagesWoche vom 13.09.13