An der Europameisterschaft mag vieles geschehen, sicher aber wird der Fussball nicht neu erfunden: Taktisch kauen die Nationalteams bloss nach, was in den Clubs gekocht wird.
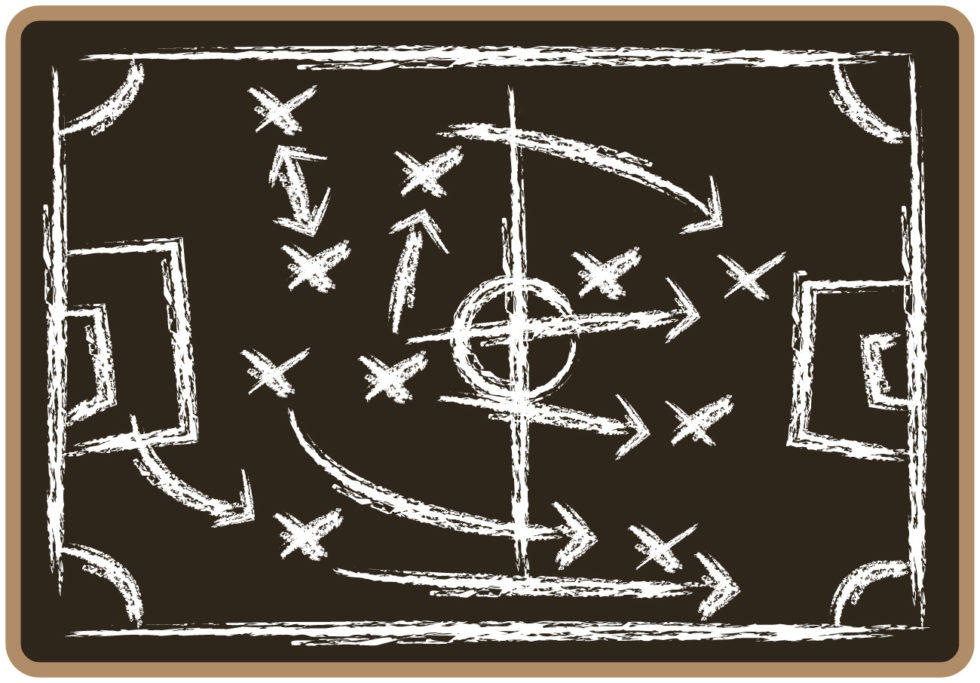

Um ein Haar wäre der Revolutionär im Heizungsbau gelandet. So frustriert war Walerij Lobanowskyj über die biedere Spielweise seines Teams Schachtar Donezk, dass er nichts mehr mit Fussball zu tun haben wollte. Doch anstatt sich in seinen bürgerlichen Beruf zurückzuziehen, wurde er ein Jahr später, 1969, selbst Trainer, um seine Ideen des Spiels zu verwirklichen. Und er machte sich daran, den Fussball von Grund auf zu erneuern.
Damit ist die Europameisterschaft in Polen und der Ukraine auch eine Rückkehr zu den Wurzeln des modernen Fussballs. Denn während an der WM 1970 in Mexiko mit Brasilien ein letztes Mal jenes Team triumphierte, das die besten Spieler auf das Feld schickte und sie Spass haben liess, arbeitete der Ukrainer Lobanowskyj in der damaligen Sowjetunion an der Verwissenschaftlichung des Fussballs.
Um die Belastung seiner Spieler besser zu erkennen, war ab seiner Anstellung bei Dynamo Kiew (1973–1990) ein Spezialist für Bioenergetik sein engster Vertrauter. Lobanowskyj selbst konzentrierte sich auf Taktiken, liess die Trainings von einem anderen Mitglied des Trainerstabs leiten und hatte einen Mitarbeiter, der eigens angestellt war, um Statistiken zu jedem seiner Spieler zu sammeln.
Die meisten Trainer der EM wandeln, wohl nicht wissentlich, in Lobanowskyis Spuren
Das Spiel, das daraus entstand, klingt auch heute noch modern: eine Mannschaft, in dem alle Spieler für Offensive und Defensive verantwortlich sind, unabhängig von ihrer Position in der Startformation, flache Viererkette in der Abwehr und ein mit hoher Laufbereitschaft ausgeführtes Pressing. Was heute zum Standard gehört, war damals revolutionär.
Die Trainer der 16 EM-Teilnehmer mögen mit ihrer Arbeitsweise und ihren Spielsystemen – die meisten wohl nicht wissentlich – in den Fussstapfen Lobanowskyjs wandeln. Revolutionäre aber wird diese Euro keine hervorbringen. Und das liegt nicht daran, dass alle Pfade ausgetrampelt wären.
Die Nationalmannschaften sind schlicht von den grossen Clubteams überholt worden. Der modernste Fussball wird nicht an den grossen Turnieren wie Welt- oder Europameisterschaften gezeigt. Sondern vor allem in der europäischen Champions League.
Manchmal greifen die Trainer auch zu Grossmutters Kochbuch
In den nationalen Auswahlen wird höchstens nachgekaut, was die Küchen der Vereinsmannschaften vorkochen. Wenn nicht sogar aus purer Angst vor der Niederlage gleich auf das Rezept aus Grossmutters Kochbuch zurückgegriffen wird. Manchmal sogar mit Erfolg, wie das Beispiel der betonierenden Griechen 2004 beweist.
Das ist zwar keine neue Entwicklung. Schon früher wurden neue Taktiken erst in Vereinsmannschaften entwickelt, ehe sie auch die Nationalteams übernahmen. Das gilt für den «Schweizer Riegel», mit dem die zuvor chronisch erfolglose Schweiz 1938 das Deutsche Reich besiegte, genauso wie für den holländischen «Totaalvoetbal», der 1974 erst im WM-Final scheiterte, oder das «Gioco all’italiana», mit dem Italien 1982 Weltmeister wurde.
Die Uniformität des modernen Fussballs
Es leuchtet ein, dass es mit täglicher Arbeit einfacher ist, komplexe Laufwege einzustudieren als mit ein paar wenigen Zusammenzügen pro Jahr. Doch massen sich früher an einer Endrunde noch verschiedene Spielphilosophien, so wurde am letzten grossen Turnier, der WM 2010, vor allem eines sichtbar: Die Uniformität des internationalen Fussballs im fast schon Standard gewordenen 4-2-3-1; mit den siegreichen Spaniern als sich aus der Masse herauskombinierender Ausnahme.
Wobei auch die spanische Auswahl als Trendsetter in Sachen Passspiel im Schatten des FC Barcelona steht. An der EM 2008 spielten die Spanier die meisten Pässe. 450 waren es im Schnitt pro Partie. Mit diesem Wert wären sie in der Champions-League-Saison 2010/11 nur noch auf dem siebtletzten Platz aller 32 Mannschaften gelandet. Führend hier natürlich Barça mit durchschnittlich 791 Pässen.
Um diesen Trend der Clubs zu immer mehr Kurzpässen und ewiger Ballkontrolle zu bremsen, ist wohl mehr als der EM-Sieg einer schnell konternden Mannschaft nötig. In der Champions League ist die Anzahl von Kontertoren von 2005 bis 2011 von 40 auf nur noch 21 Prozent gesunken. Deutschland wird sich an der Euro trotzdem im Stil des schnellen Umschaltens versuchen. Aber auch hier gilt: Ein Club setzt den Massstab. Als Vorbild nennt Bundestrainer Joachim Löw offen den deutschen Meister Dortmund.
Die Spieler bürgen für Spektakel
Spektakuläre Spiele – und das ist für den Zuschauer das Wichtigste – wird es an dieser Euro übrigens trotzdem geben. Dafür bürgt die Qualität der anwesenden Spieler.
Und während sie drei Wochen lang dem EM-Titel nachrennen, tüfteln Clubtrainer zu Hause daran, wie der Fussball aussehen könnte, in dem die einstmals fixen Positionen der Spieler auf dem Feld aufgelöst werden. Der 2002 gestorbene Walerij Lobanowskyj hätte seine Freude.
Das wohl beste Team der Sowjetunion, trainiert von Walerij Lobanowskyj, hier im Halbfinal gegen Italien (2:0). Das Motto: Pressing, Pressing, Pressing – und alle Spieler sind für Offensive und Defensive verantwortlich.
Artikelgeschichte
Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 08.06.12
