«But these go to eleven», sagt Rock-Ikone Nigel Tufnel mit Nachdruck, als es der Doku-Filmer von «This Is Spinal Tap» (1984) wagt, den Sinn des eigens für Tufnel angefertigten Gitarren-Verstärkers anzuzweifeln. Warum schnallt der Depp von Filmer nicht, was der Unterschied ist zwischen seiner Verstärkerbox, deren Regler bis 11 gehen – und den üblichen Modellen, die nur bis 10 gehen? «It’s one louder!», insistiert Tufnel.
Die Szene ist Kult, Freunde lauter Musik und schriller Musikerklischees lieben sie.
Musik soll, muss laut sein. Ohne Lautstärke kann keine Freude aufkommen, wenn es auf der Bühne rockt oder rappt, wenn DJs Beats und Bässe aus den Boxen dröhnen lassen, so, dass Ohr und (Magen-)Wände im Takt mitvibrieren. Jeder weiss es, ob Fasnächtler, Clubber, Jazz-Fan oder Operngänger: Es braucht die lauten Töne. Auch, wenn die Strassen der Stadt den Tambouren, Pfeifern und Guggen gehören, wenn Open-Air-Konzerte stattfinden, wenn das gesamte Orchester aufdreht.
Vol-ume, voll rum, den Hebel, unbedingt. Das muss sein dürfen.
Aber…
…nicht überall, und nicht andauernd. Wenn ich nach einem harten Tag unter der Woche im Park oder am Rheinufer sitze und es vielleicht mal nicht regnet, dann habe ich Lust auf die Gesellschaft von Kollegen. Wahrscheinlich auf ein Bierchen.
Worauf ich kaum Lust habe, ist die Tatsache, dass vorne links irgendein Electro-Beat aus einem Bluetooth-Böxli scherbelt, während hinten rechts einer fette Reggae-Bässe aus einer Rollkoffer-Box in den Basler Abend bombt, dazu von Unbestimmt ein undefinierbares Popgedüdel im Mix mitschwingt – und darauf, es sei hier nicht unerwähnt, auch noch zuschauen und -hören zu müssen, wie schräg vor der untergehenden Sonne ein Hobby-Samba-Trommler satanisch schlechte Rhythmen rausrumpelt.
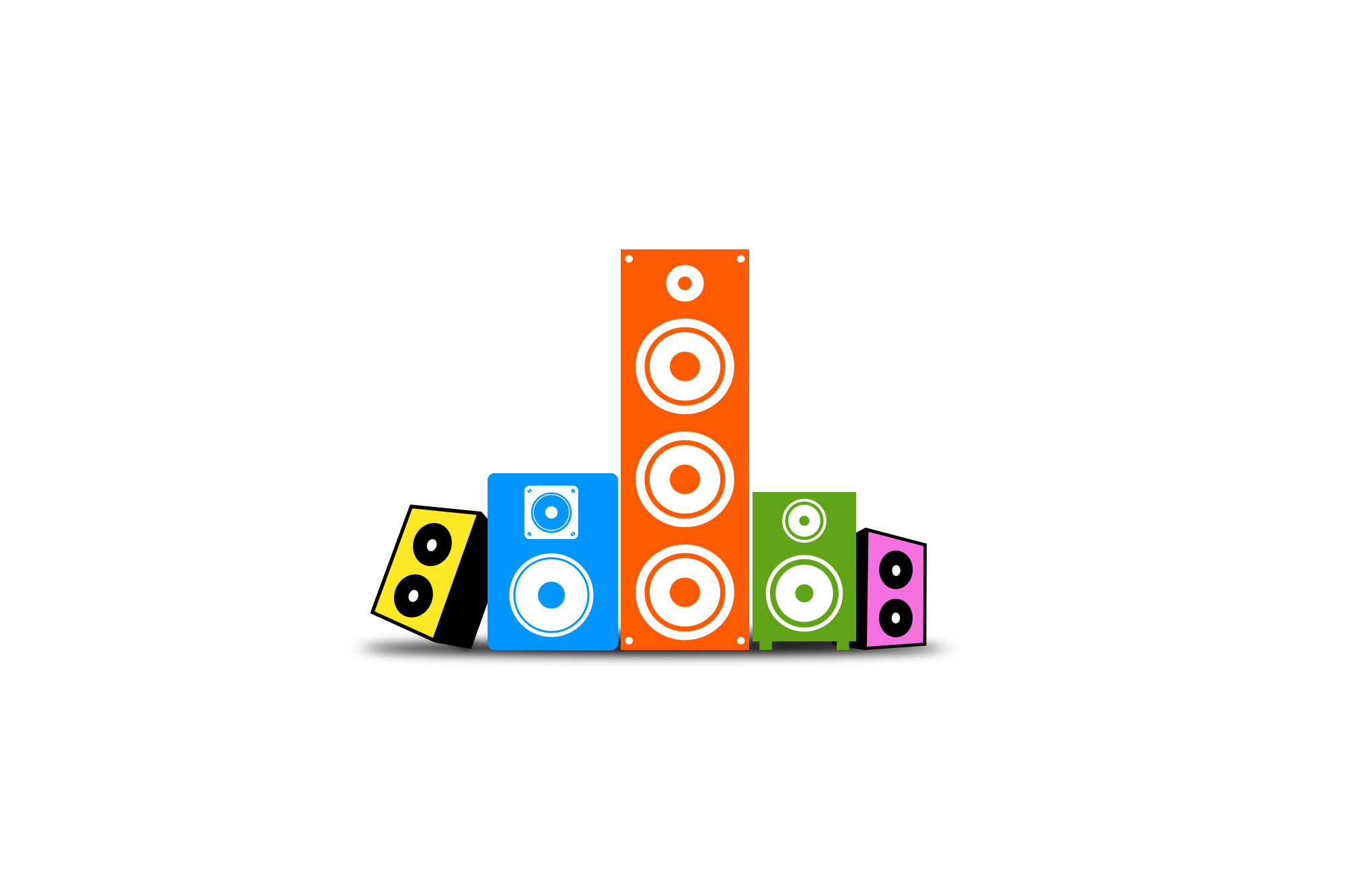
Fette Speaker, nett gruppiert: Am richtigen Ort und Anlass immer gern. Ansonsten können sie TagesWoche-Journalist Gabriel Brönnimann gestohlen bleiben. (Bild: Nils Fisch, TagesWoche)
Lösungen
Es gibt exakt vier Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen.
Die erste kommt reflexartig: Man wünscht sich Nigel Tufnels Verstärker («It’s One Louder!»), um kurz mal alle Störenfriede wegzublasen und gleichzeitig wenigstens den eigenen Sound zu hören, statt den nervenaufreibenden Sound-Mix aller anderen. Dann könnte man sich, etwas lauter als zuvor, wieder Kollegen und Bier zuwenden.
Das Problem mit Möglichkeit 1, Aufrüstung, ist bekanntlich, dass sie das Problem verschärft. Damit wären wir bei Möglichkeit 2: Der multilateralen Abrüstung. Sprich: Verhandlung. Wer schon mal versucht hat, Leute mit lauten Boxen mit freundlichen Worten zum Leiserdrehen zu bewegen, der weiss, dass er mit lauten Worten rechnen kann. «Figg di Maaaan!». Das ist das Problem mit Variante 2. Vor allem, wenn man eigentlich ja nur ein Bier mit Kollegen, gemütlich…
Möglichkeit 3, das habe ich mir auch schon anhören dürfen, ist: Wem es in der Stadt nicht passt, der soll halt auf’s Land ziehen. Differenziert argumentierenden Vertretern dieser Ansicht wünsche ich zuweilen – obwohl ich zugegebenermassen kein grosser Fan bin – ein ganzjähriges Tattoo im Innenhof und 100 geplante Chemie-Türme neben dem Quartiertreff. Dann können wir wieder reden.
Die vierte Lösung ist die, dass man bestehende Gesetze umsetzt. Es ist nichts anderes passiert als das. Dass die Behörden ihre Kommunikation in diesem Fall nicht im Griff haben (einerseits «Lautsprecher und Allmend: Das geht!» – andererseits die Realität: «Nein, es geht nicht für private Anlässe») – das ist natürlich mehr als nur unglücklich. Aber dass die verschärfte Durchsetzung des Verbots andererseits nicht dazu führen muss, dass jeder Jugendliche, der sich mit MP3-Böxli mit seinen Kumpels beim Skaten, Fussballspielen, beim Durch-die-Stadt-Spazieren immer gleich gebüsst wird: Auch darauf darf man hoffen.
Man darf bedauern, dass es das Gesetz braucht. Mit dem richtigen Ohrenmass angewendet, ist es aber keine schlechte Sache. Im Gegenteil: Dort, wo viele Menschen sich jeden Tag zum gemütlichen Beisammensein treffen – etwa am Rhein, auf Plätzen, in Parks –, braucht es nicht auch noch jeden Tag Sound.
Diskussion
Nennen Sie mich intolerant, Snob, Duubel, wenn Sie müssen. Aber denken Sie dabei ans Tattoo in Ihrem Innenhof. Und sagen Sie mir doch lieber, warum alles, was ich gesagt habe, nicht zum Anhören ist. Mit Argumenten – in den Kommentaren.
